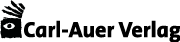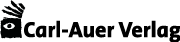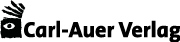Die Berge wegdenken - Warum Macht im Wandel oft ausgeblendet wird
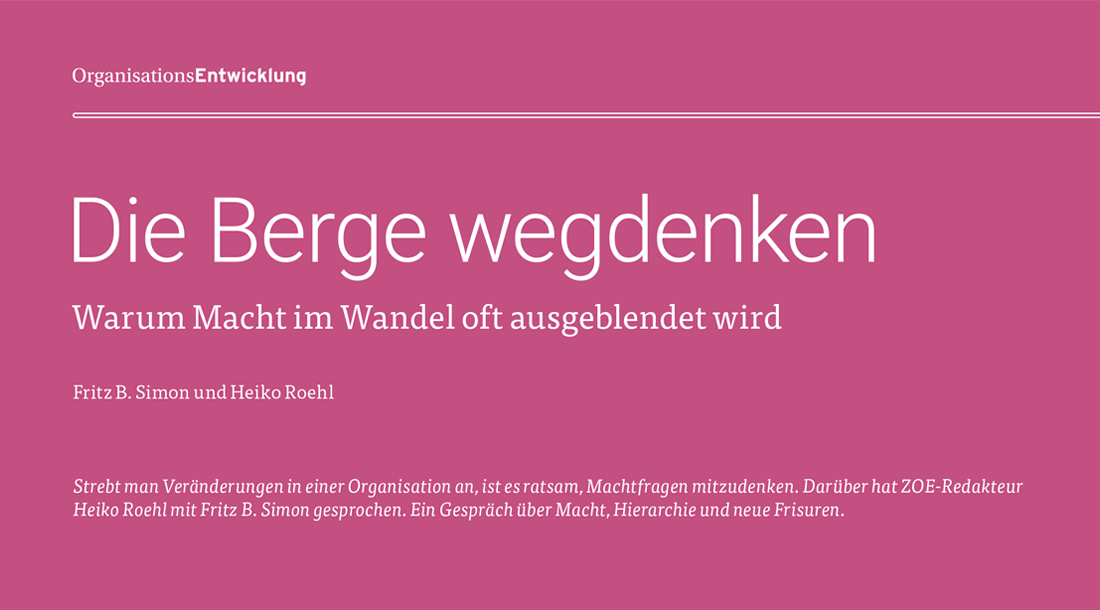
Erstveröffentlichung in der OrganisationsEntwicklung 2/2022, www.zoe-online.org, Copyright: ©Handelsblatt Media Group.
Strebt man Veränderungen in einer Organisation an, ist es ratsam, Machtfragen mitzudenken. Darüber hat ZOE-Redakteur Heiko Roehl mit Fritz B. Simon gesprochen. Ein Gespräch über Macht, Hierarchie und neue Frisuren.
ZOE: Herr Simon, was muss man über Macht wissen, wenn man Veränderungsprojekte betreut?
Simon: Was mir generell auffällt, ist, dass die bestehenden Machtverhältnisse in Veränderungsprozessen oft von Kunden wie Beratenden nicht mitkalkuliert werden. Oft herrscht bei den Beteiligten die Auffassung, mit genügend wohlmeinenden Leuten könne man jede Organisation verändern – auch gegen den Willen derer, die über die formale Macht verfügen. Das halte ich für einen Denkfehler. Hierarchie in einer Organisation ist ja nichts generell Böses, sondern etwas hoch Funktionelles. Des wegen kann man sie nicht einfach abschaffen, sondern muss sie mitdenken, wenn man Veränderungen in einer Organisation anstrebt. Man muss strategisch planen, wie sich die entsprechenden Strukturen nutzen lassen. Und dazu gibt es spezifische Ansatzpunkte. Wenn man die bestehenden hierarchischen Strukturen nicht als Ausgangspunkt wählt, begibt man sich gewissermaßen auf eine Wanderung ins Gebirge und denkt sich die Berge weg.
ZOE: Warum neigen Menschen dazu, das Thema Macht auszublenden? Wir sehen das bei der Pandemie im Moment ja auch ziemlich deutlich.
Simon: Ich glaube, es gibt zwei Tendenzen, die auch in der Pan demie beobachtbar sind. Die eine besteht in dem Irrglauben, den schon Margaret Thatcher vertrat, dass es keine Gesellschaft gibt, sondern nur Individuen. Soziale Systeme sind in diesem Denkmodell nur lose aus Individuen zusammengesetzte Gruppen, und wenn die Individuen motiviert oder von etwas überzeugt werden, kann man soziale Verhältnisse verändern. Wie falsch diese Auffassung ist, kann man an der Corona Impfkampagne sehen. Wenn zwanzig Prozent der Bundesbevölkerung sich nicht impfen lassen, ist die Pandemie offenbar nicht zu stoppen. Überzeugte Impfgegner wird man auch durch noch so bemühte Motivationsversuche nicht zum Impfen bringen. Sie folgen ihrer individuellen Rationalität. Anders dürfte das Ergebnis sein, wenn man die sozialen Spielregeln verändert und, beispielsweise, eine Impfpflicht einführt; das heißt, den Fokus der Aufmerksamkeit auf eine andere Systemrationalität lenkt. Der Einzelne muss sich nicht mehr für eine Impfung entscheiden oder dazu motiviert werden, sondern er muss sich nun gegen sie entscheiden und die sozialen Konsequenzen tragen. Was für soziale Systeme rational ist, ist oft etwas Anderes als es für Individuen ist. Die Frage ist immer: Welches System will man verändern? Die Rationalität sozialer Systeme resultiert nicht aus der Addition der Rationalität von Individuen. Darin liegt, glaube ich, der konzeptuelle Irrtum. Der zweite Aspekt ist meines Erachtens, dass es seit den 1968ern Jahren und Bewegungen starke antihierarchische Affekte bei den meisten Leuten gibt. Ich bin ja alter 68er und habe die damaligen Umwälzungen miterlebt und gemacht. Der erste Bereich, in dem ich Organisation als Mitarbeiter kennen gelernt habe, war eine große psychiatrische Anstalt. Sie war so etwas wie ein Naturpark für Organisationsformen. Da gab es tradierte hierarchische Systeme, z. B. Stationen, deren Stationspfleger schon in dritter Generation diese Rolle innehatte. Die Häuser, in denen sie wohnten, hießen bezeichnenderweise «Wärterhäuser». Sie hatten Rolle und Wohnung von ihren Vätern übernommen, und die hatten sie von ihren Vätern übernommen. Das waren Feudalsysteme, in denen die Patienten oder Patientinnen sich ihre Zigaretten verdienen konnten, in dem sie die Autos der Pfleger wuschen. Auf der anderen Seite gab es basisdemokratische Abteilungen, sogenannte «Therapeutische Gemeinschaften» – ich war als Arzt für so eine verantwortlich –, in denen die Patienten kollektiv Entscheidungen treffen sollten. Heute würde man dies unter dem Namen Agilität verkaufen. All das war für mich ein wunderbares und gruseliges Erfahrungs und Übungsfeld. Leute, die etwas verändern wollen, sehen hierarchische Strukturen in der Regel als ein Problem. Oft zu Recht, weil Hierarchen häufig schwachsinnige Entscheidungen treffen und überhaupt nicht wissen, wovon sie reden. Denn sie verfügen oft gar nicht über das notwendige, kleinteilige operative Wissen. Aber die AllesoderNichtsAlternative: Entweder basisdemokratisch oder autoritärtyrannisch, die wird weder der täglichen Praxis in den Organisationen gerecht, noch sind daraus wirklich sinnvolle Veränderungsmodelle abzuleiten.
ZOE: All diese Ansätze, Agilität, Basisdemokratie, die ganzen gro ßen Revolutionen, haben die etwas daran geändert, wie Macht in Organisationen funktioniert? Oder ist es nicht so, dass das eine Vorderbühnenfassade ist, hinter der alles eigentlich genauso wie immer läuft? Ist es gelungen, Macht in Organisationen wirklich zu demokratisieren?
Simon: Nein. Ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, Macht zu demokratisieren in Organisationen. Natürlich kann und soll te man sie als Rolleninhaber höchst unterschiedlich nutzen. Und ich glaube, dass sich das Selbstverständnis von Führungs kräften in den letzten 50 Jahren radikal verändert hat. Heute spielen da auch systemtheoretische Führungskonzepte eine wichtige Rolle. Die eigentliche Frage ist meines Erachtens ja nicht, ob es Hierarchien geben sollte, sondern: Was ist eigentlich die Funktion von Hierarchie bzw. von formaler Macht?
Sie wollen den Artikel gerne weiterlesen? Hier können Sie die komplette Ausgabe als ePaper lesen.