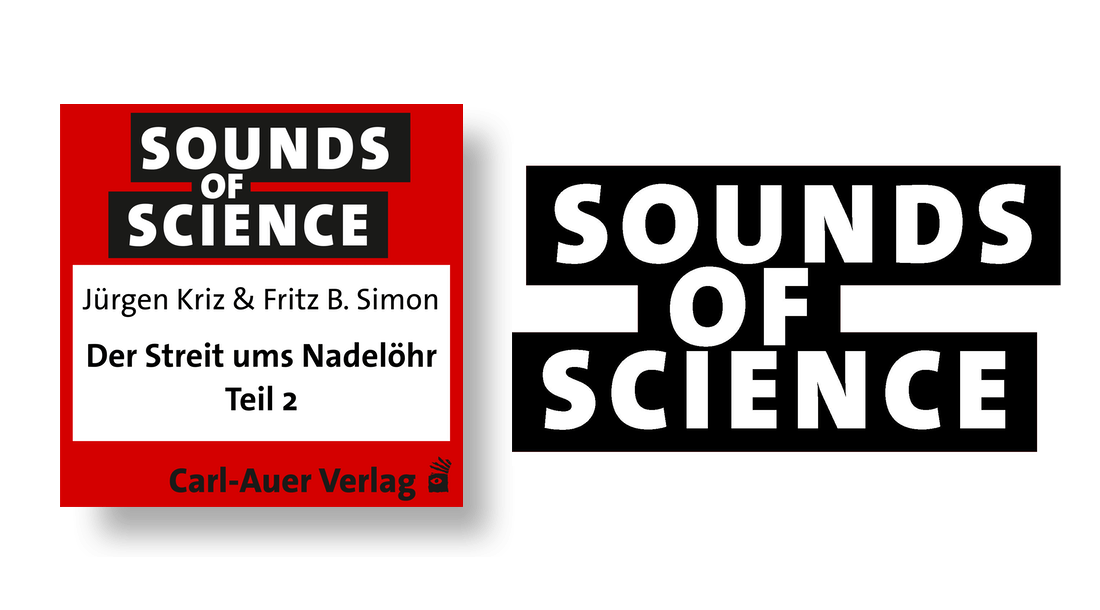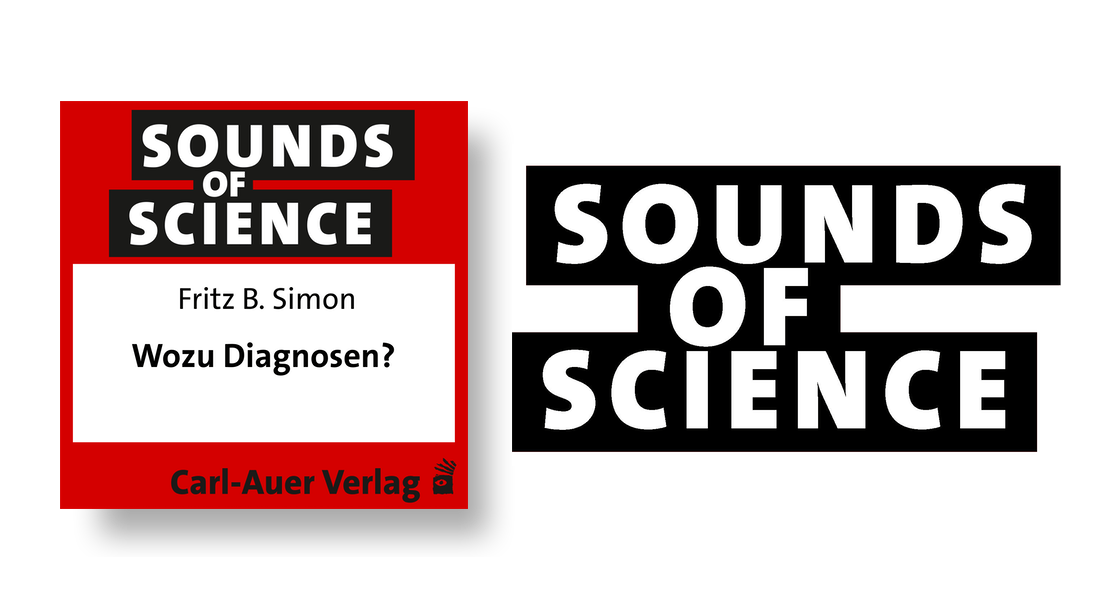Nur wer logisch denkt, kann verrückt werden!
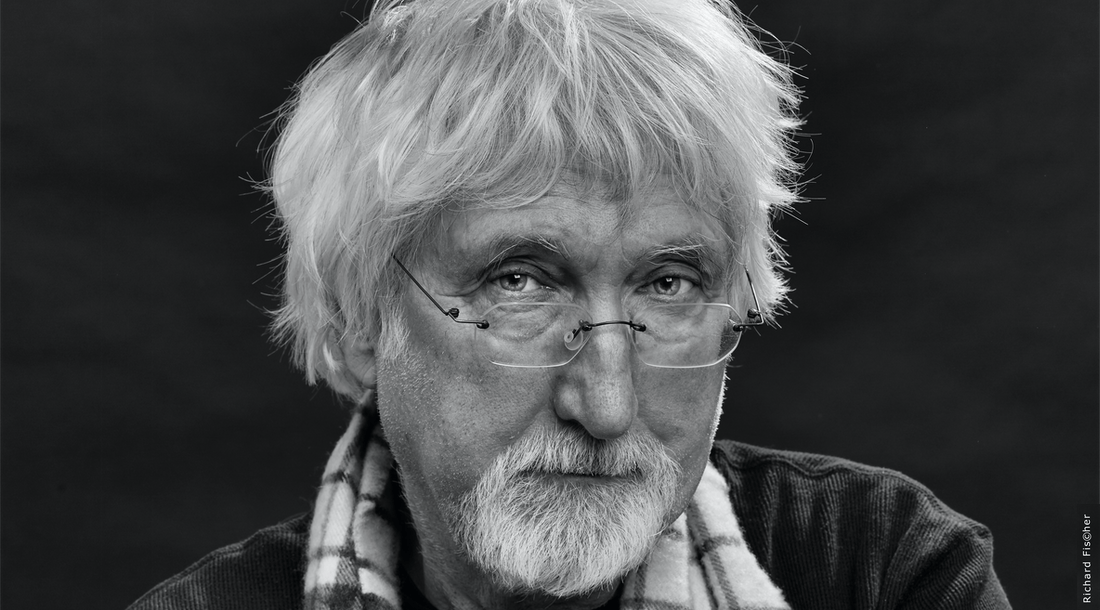
Paradoxien in Gesellschaft, Organisationen und Familien sowie „konkrete Rezepte“ zu Kommunikation. Elvira M. Gross und Ulrich P. Hagg im Gespräch mit Fritz B. Simon im Rahmen der Paul Watzlawick Tage zum Thema „Humor und Paradoxie im Spannungsfeld der Kommunikation“ am 18. Oktober 2019. Erschienen in: Systeme, interdisziplinäre Zeitschrift für systemtheoretisch orientierte Forschung und Praxis in den Humanwissenschaften, Jg 34(1), 2020
Elvira M. Gross: Herr Simon, Ihre Buchtitel sind unter anderem: „Meine Psychose, mein Fahrrad und ich“ und „Die Kunst, nicht zu lernen“ – das sind ungewöhnliche Titel. Haben Sie diese beim Schreiben schon im Kopf gehabt?
Fritz B. Simon: Ja, die konnte ich auch nur auf meine Bücher schreiben, weil ich in meinem Verlag publiziert habe. Und das heißt, die Mitarbeiter hatten keine Chance, sich gegen die Titel zu wehren, obwohl sie alle völlig entsetzt waren. Diese Schamlosigkeit kann man sich nur leisten, wenn einem der Laden mitgehört.
E.G.: Sie haben einmal gesagt, dass Sie alles immer sehr genau gliedern, wenn Sie an ein Buch herangehen.
F.S.: Nein, ich muss nur immer zwei Seiten vorne freilassen. Das heißt, ich habe lediglich eine vage Idee, dann fange ich an zu schreiben und dann ergibt sich sozusagen der Weg beim Gehen. Dieser Satz ist gar nicht von Buddha, sondern von mir. Für mich ist Schreiben wie eine Reise, ich fange an zu schreiben und habe keine Ahnung, wo ich lande. Das führt dazu, dass man beim Schreiben Dinge denkt, die man nie gedacht hätte, wenn man nicht geschrieben hätte. Es gibt Studien, die zeigen, dass man normalerweise nicht länger als drei Minuten bei einem Thema bleibt, das heißt, man springt von Thema zu Thema. Innerhalb dieser drei Minuten ist man üblicherweise relativ konsistent in dem, was man denkt – das Gedachte passt zum Fühlen und ist auch einigermaßen logisch. Nach einer Stunde ist man bei einem anderen Thema, das wieder zu den Gefühlen passt und auch wieder einigermaßen logisch ist, allerdings ist es im Widerspruch zu dem, was man vor einer Stunde gedacht hat. Das merken aber immer nur die anderen und die sagen dann: „Vor einer Stunde hast du noch von etwas ganz anderem erzählt, wie geht das zusammen? Und dein Handeln passt sowieso nicht zu dem, was du jetzt gerade sagst, und zu dem, was du gestern gemacht hast.“ Darauf kommt man, wenn man schreibt, weil der Computerbild schirm ist so etwas wie ein Rogers Therapeut, der einem widerspiegelt, was man gedacht hat, und dann ist man damit konfrontiert: „Das passt ja überhaupt nicht zu dem, was ich gestern geschrieben habe.“ So ist man gezwungen diese Widersprüche irgendwie aus dem Weg zu schaffen und kommt nur deswegen dazu, insgesamt ein konsistentes Bild zu entwickeln. Meine These ist ja, wer nicht schreibt, denkt schlampig und ich habe auch noch niemanden getroffen, der ein konsistentes Modell hat, wenn er nicht schreibt. Die meisten Leute, die gute Praktiker sind, sind gute Praktiker. Offensichtlich braucht man dazu kein konsistentes Modell. Wenn man die danach fragt, warum sie dieses oder jenes gemacht haben, sagen sie: Ist doch klar, was hätte man sonst machen können? Zu schreiben ist so, wie in eine Entwicklungs- oder Forschungsabteilung einer Firma zu gehen. Da kommt man zu neuen Ideen. Jeder, der etwas denken will, was er bisher noch nicht gedacht hat, sollte anfangen zu schreiben. Er muss es ja nicht unbedingt publizieren.
E.G.: Sie haben ja auch gesagt, dass Sie Theorien so lieben, weil sie so praktisch sind.
F.S.: Ja natürlich, weil wenn man eine gute Theorie hat, schützt man sich davor, in konsistente Sachen zu machen. Und so mit dem Hintern einzureißen, was man mit den Händen aufgebaut hat. Das systemische Modell mit der Wunderfrage finde ich sehr schön, nebenbei gesagt auch, dass Paul Watzlawick die schon sehr früh gestellt hat. Steve de Shazer war ja auch am MRI2 und wird sie dort gehört haben. Und das Schöne am systemischen Arbeiten ist: man kann alle Methoden verwenden und wenn es funktioniert, ist es immer systemisch. Die Systemtheorie hilft einem zu re flektieren, was man da macht, und zu gucken: Passt das, was ich heute mache, zu dem, was ich gestern gemacht habe, und überhaupt zu dem Kontext, zu dem Beziehungsangebot, das ich als Berater oder Therapeut machen möchte. Es gibt ja auch Leute, die einen autoritären Zugang zum systemischen Arbeiten vertreten, und das passt dann eben nicht zu einem konstruktivistischen Modell. Wenn ich mich daran orientiere, kann ich nicht behaupten, dass ich die Wahrheit gepachtet habe. Das heißt natürlich nicht, dass ich meine Erfahrung verbergen muss. Ich mache es so, dass ich sage: „Ich kann mich ja täuschen, ich bin nicht der Papst, auch wenn ich jetzt das passende Alter dafür habe, aber in den letzten 300 Fällen hat es funktioniert.“ So kann man seine Erfahrung zur Verfügung stellen und man eröffnet dem Klienten die Chance, „Nein“ zu sagen, ohne die Beziehung in Frage zu stellen.
E.G.: Was waren wichtige Wegweiser auf Ihrem bisherigen Weg?
F.S.: Das wichtigste Buch in meinem Leben war „Lösungen“ von Paul Watzlawick. Ich habe damals in der Psychiatrie gearbeitet. Wir waren 25 in einer großen Anstalt mit 1200 Patienten. Ich war für die Aufnahme in der Station zuständig und hatte keine Ahnung, was ich da tun soll. Ich hatte immer die großen dicken Pfleger in ihren weißen Anzügen gefragt, was ich tun soll. Und die haben mir gesagt, welche Medikamente ich wie dosieren soll, und ich habe es brav gemacht. Irgendwann kam ein Emanzipationsschritt von den Dicken in Weiß. Psychoanalyse macht ja relativ wenig Sinn, wenn sie es mit einem tobenden Patienten zu tun haben. Man braucht aber irgendwie einen Theorierahmen, um nicht nur einfach wie in der Lotterie auszuspielen, welches Verhalten gut ist – und irgendwann hat mir eine Kollegin das Buch „Lösungen“ geschenkt. Ich habe es bis zur Hälfte gelesen und angefangen, mit einem kommunikationstheoretischen Ansatz zu arbeiten. Der Blick auf Kommunikation war neu und so fantastisch, da man nie nur den Patienten als Objekt, bei dem eine Schraube locker war, gesehen hat, sondern sich als Beobachter immer mit einbezogen hat. Mit einer Sozialpädagogin und einer Psychologin, die mit schizophrenen Jugendlichen gearbeitet hat, haben wir dann versucht, eine therapeutische Gemeinschaft zu machen. Und da wurde uns mit diesem kommunikationstheoretischen Blick relativ schnell klar, dass wir permanent paradoxe Anweisungen an unsere Patienten gaben, und dann haben wir einen Artikel geschrieben: „Gefahren der paradoxen Intervention im Rahmen der therapeutischen Gemeinschaft“. Den hat diese Kollegin irgendwann Paul Watzlawick in die Hand gedrückt und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
E.G.: Der Therapeut oder die Therapeutin ist ja bekanntlich immer Teil des Systems. Wie kann er oder sie als Teil der Kommunikation, also als Mitspieler_in, die Außenperspektive einnehmen?
F.S.: Die Außenperspektive hat ja jeder. Wir sind nie Teil der Kommunikation, sondern wir beteiligen uns an der Kommunikation. Hier im Saal sitzen lauter Leute, die sich an der Kommunikation beteiligen, indem sie nichts sagen. Weil es ihre Rolle ist. Und sie gucken auf uns aus zwei Perspektiven: Was für ein Kommunikationsmuster ist das hier? Gleichzeitig gehen sie ihren Gedanken nach, das heißt, die Psyche ist weit draußen aus der Kommunikation. Wir beteiligen uns zwar an der Kommunikation, aber man ist immer in der Außenperspektive und hat die Option – und das ist das Schöne am kommunikationstheoretischen Ansatz –, ob das denn sinnvoll ist, wie ich mich beteilige. Sollte ich nicht was anderes tun, nachdem ich schon 33 Mal versucht habe auf diese Weise zum Ziel zu kommen, vielleicht sollte ich es beim 34. Mal anders versuchen?
E.G.: Sie haben ja in Bezug auf Wirklichkeitskonstruktionen die Unterscheidung gemacht zwischen „Beschreiben“, „Erklären“ und „Bewerten“. Warum ist das so hilfreich?
F.S.: Ich halte sie aus praktischen Gründen für sehr hilfreich. Mit der Beschreibung kann man sich über das, was man wahrnimmt, unterhalten. Da kann man sich relativ leicht einigen. Wenn Sie einen Autounfall haben und Sie haben drei oder vier Zeugen, dann sehen Sie, dass auch das nicht so einfach ist. Was aber viel schwieriger ist, ist die Frage: „Wie kann man das erklären?“ Wie konstruiere ich die Kausalität für diese vermeintlichen Fakten? Weil dann wird es auch im privaten Bereich politisch. Wie ist die Karre an die Wand gefahren worden? Und dann gibt es natürlich noch den Aspekt der Bewertung, denn je nachdem, wie ich es bewerte, konstruiere ich andere Erklärungen. In einem meiner Bücher habe ich eine Anekdote aus einer Therapie beschrieben, die ich mit Gunther Schmidt erlebt hatte. Wir hatten eine Familie, wo der Sohn das Problem darstellte, er war 21 und die Familie schilderte, dass er beim Frühstück die volle Tasse Kaffee an die Wand geworfen hat. Darüber konnte man sich einigen. Aber die Erklärungen waren sehr verschieden. Der Vater sagte: „Es ist reine Bosheit, denn ich habe das Zimmer gerade eine Woche vorher tapeziert und er hat da schon nicht mitgeholfen. Das muss sanktioniert werden!“ Und die Mutter sagte: „Der Junge ist krank.“ Also nicht er hat geworfen, sondern die Krankheit. Die dritte war die Großmutter, die hatte die originellste Erklärung, deswegen habe ich mir die Geschichte gemerkt: „Der Junge ist besessen.“ Wenn Sie genau hinschauen, dann ist das Besessenheits-Modell nicht weit weg vom Krankheitsmodell. Einmal ist es die Krankheit, die geworfen hat, einmal ein böser Geist. Der junge Mann selber hat sich, schlau wie er war, herausgehalten und keine Erklärung geliefert. Man hat dann auch drei Ebenen, wo man versuchen kann zu intervenieren. Wo schauen die Leute hin? Wo sollen sie hinschauen? Wie kann ich die Aufmerksamkeit auf was anderes fokussieren, auf etwas, was funktioniert, statt auf das, was nicht funktioniert? Oder ich kann alternative Erklärungen anbieten oder positive Konnotationen geben, um alternative Bewertungen anzuschauen. Die können dann helfen, dieses festgefahrene Muster und die Wiederholung von immer demselben Muster zu unterbrechen – damit kann man einen Fuß in die Türe kriegen.
E.G.: Sie schrieben: „Nur wer logisch denkt, kann verrückt werden.“ Verrückt – normal, sind wir immer in dieser Welt der Zweiwertigkeit in unserem Denken gefangen?
F.S.: Das logische Denken hat ja seinen Platz. In der Mathematik, aber nicht im Alltag. Wer logisch denkt, kommt überhaupt nicht morgens aus dem Bett. Nehmen Sie das logische Konzept der Identität, das heißt, dass bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Aber kein Mensch hat, wenn er dieselbe Identität zu haben glaubt, im mer dieselben Eigenschaften. Schon tags und nachts über ist man sehr verschieden und umso mehr, wenn man in verschiedene Kontexte geht. Es gibt ja viele Psychiater, die reden von kindlichen Psychosen. Ich glaube, das ist Quatsch, um es deutlich zu sagen, weil man muss erst zweiwertig konsistent logisch denken und das tut man normalerweise erst mit 16, 17. Erst wenn ich anfange das zweiwertige Konzept der Identität auf mich zu übertragen, komme ich in 1000 Klemmen, weil ich auf einmal in der pragmatischen Paradoxie stecke, dass ich mich in einer Weise wahrnehme, die nicht zu meiner vermeintlichen Identität passt. Katatonie ist zum Beispiel eine wunderbare Lösung, nichts Falsches zu tun, wenn ich zwei sich ausschließende Handlungsanweisungen habe. Wenn ich nicht logisch denke und man gibt mir zwei sich ausschließende Handlungsanweisungen, dann ist das für mich überhaupt kein Problem. Dann sag ich: „Ich pfeif drauf! Ich mach das eine und nicht das andere!“ In dem Moment aber, wo ich denke, ich möchte konsistent logisch beiden Seiten gerecht werden, weil sonst etwas Schlimmes passiert, dann habe ich ein Problem. Insofern glaube ich, dass die Double Bind Theorie von Bateson, die am Anfang unseres Modells stand, bis heute extrem relevant ist und wichtig genommen werden muss.
E.G.: Da spielt ja auch der Faktor Macht eine große Rolle.
F.S.: Ja, das kommt bei dem Double Bind Modell dazu. Es reicht ja nicht, nur aus schließende Handlungsanweisungen zu kriegen, sondern es muss auch ein lebenswichtiger Kontext sein, den ich nicht ohne Weiteres verlassen kann und wo auch noch Metakommunikation im Sinne von „das geht ja gar nicht“ verboten ist. Macht ist auch ein sehr spannendes Konzept, das in der systemischen Szene noch viel zu wenig reflektiert worden ist. Man kann sagen, das systemische Feld, wie es heute ist, hat zwei Wurzeln: Die eine kommt aus Palo Alto, von Bateson, Watzlawick und Erickson, die anfingen mit kleinen sozialen Systemen zu arbeiten – mit Paarbeziehungen, Familien bis zum Team – überall wo man Face-to-Face-Kommunikation hat. Die zweite Wurzel kommt aus der Soziologie und Luhmann ist derjenige, der dafür repräsentativ ist, weil er die Gesellschaft als Kommunikationssystem versteht und bei dem größten denkbaren menschlichen Kommunikationssystem angefangen hat – der Weltgesellschaft. Er hat das dann durchdekliniert, über die Funktionssysteme Wirtschaft, Erziehung, Wissenschaft bis hin zur Organisation. Das ist dann der Punkt wo die Face-to-Face-Kommunikationsforscher sich mit den Organisationsforschern getroffen haben. Denn da hat es eine Schnittmenge gegeben, die dann beide interessierten. Insofern glaube ich, dass das eine ideale Ergänzung war – von den ganz großen Systemen zu den kleinen und in der Mitte trifft man sich.
E.G.: Es sind ja alles lebende Systeme, die Familie als kleine Einheit oder ein Unter nehmen. Wie unterscheiden sich deren Beratung oder Kommunikation? Alles lässt sich wahrscheinlich nicht übertragen, aber vieles wahrscheinlich doch?
F.S.: Das ist ein großes Problem für Leute wie mich, die aus der Therapie kommen und, sobald sie in Organisationen arbeiten, Familienmodelle auf Organisationen übertragen. Weil Familien sind die einzigen sozialen Systeme, mit denen fast jeder Erfahrungen hat. Familie und Schule sind die beiden Systeme, denen man ausgeliefert ist. In der Familie hat man sehr enge emotionale Beziehungen, in der Schule hat man weniger emotionale Beziehungen, aber man lernt, wie man mit Peers und Hierarchien umgeht, das ist die eigentliche Aufgabe von Schule. Alles andere vergisst man sowieso. Wenn man nun das Familienmodell auf Organisationen überträgt und dann als Chef denkt, man müsste eine Vater oder Mutterrolle einnehmen, dann hat man seinen Job verfehlt. Denn Organisationen sind in einer Hinsicht vollkommen anders als Familien: Sie überleben deswegen, weil jeder einzelne Mitarbeiter im Prinzip austauschbar ist. Wir haben Familienunternehmen wie Daimler Benz untersucht, die waren zweihundert Jahre alt, die gibt es noch. Die katholische Kirche – eine spezielle Form von Organisation – gibt es seit 2000 Jahren, weil eben nicht alle Päpste nur ihre Söhne auf den Thron gesetzt haben. Das heißt, es gibt bestimmte Funktionen und dann sucht man jemanden, der die Rolle übernimmt, das zu tun. Das Bürgermeisteramt ist ja auch nicht erblich – jemand wird gewählt und dann womöglich auch wieder abgewählt. Das hat emotionale Folgen und mit dieser Austauschbarkeit muss man umgehen können. In der konkreten Situation ist es natürlich wichtig, wer da miteinander zusammenarbeitet und wie die miteinander kommunizieren. Aber wie gesagt, wenn da ein paar Leute sich nicht mehr miteinander verstehen, dann bricht noch nicht die Organisation zusammen.
E.G.: Sie haben einmal gesagt, dass ein Manager oder eine Managerin es schaffen muss, dass die Organisation schlauer ist als er oder sie selbst.
F.S.: Die Organisation ist sowieso schlauer oder kann zumindest sehr viel mehr. Ich kenne keinen TopManager, der wirklich in der Lage ist, ein Auto zusammenzuschrauben. Heutzutage leben wir in einer so komplexen Welt, die sich auch so schnell ver ändert, dass kein Mensch mehr alleine in der Lage ist, wirklich sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Ich brauche dann ein Kommunikationsforum, ein Führungsteam, wo unterschiedliche Kompetenzen zusammengespannt werden und unterschiedliche Sichtweisen zusammenkommen. Denn es geht immer um Entscheidungen, deren Richtigkeit sich erst in der Zukunft erweist, und kein Mensch weiß, wie die Zukunft ist. Ich nenne das gerne „Mehrhirndenken“. Deswegen glaube ich, dass verantwortliche Führung immer Führungsteams sein müssen und die Aufgabe von Führungskräften ist in erster Linie, solche Foren zu schaffen. Die müssen nicht die schlausten sein, sondern sie müssen wissen, wen sie da an einen Tisch holen. Ich selber habe in einem kleinen Institut in Heidelberg gearbeitet. Der Chef dort war Helm Stierlin und er hat Gunther Schmidt, Gunthard Weber und mich engagiert und wir haben mit ihm zusammengearbeitet. Aber wir haben uns überhaupt nicht um ihn geschert, wenn es um Ideen ging, und gemeinsam neue Ideen entwickelt und er saß begeistert da und hat mitgeschrieben und uns dauernd gesagt, wie toll wir sind. Das war sehr hilfreich. Er ist dann nach Amerika gefahren und hat unsere Ideen verbreitet. Der Chef der Nachbarabteilung, er war der Chef von Helm, hat nur Leute eingestellt, die so waren wie er, nach seinem Bild. Das hat dazu geführt, dass die Leute auch ähnliche Kompetenzen hatten wie er und dass da nie eine schlauere Idee produziert wurde, als er selber hatte. Weil, wenn eine gekommen wäre, wäre eine Wettbewerbssituation zwischen ihm und seinen Assistenten oder Oberärzten entstanden. Also die Frage ist: Wie kriegt man Kreativität in ein solches System? Sicherlich nicht, indem man eine Gruppe von Klonen zusammenspannt.
E.G.: Sie haben einmal gesagt, man brauche gute Beziehungen, um Konflikte austragen zu können. Das heißt, es braucht eine gesunde Streitkultur, wie schafft man das?
F.S.: Da gab es in den USA eine Studie, die hieß „Good to Great“. Es wurde darin untersucht, welche Firmen 15 Jahre lang am Aktienmarkt den Standard and Poor’s Index geschlagen haben, und da sind genau elf Stück rausgekommen. 15 Jahre sind eine ziemlich lange Zeit und da sind nur mehr elf von 500 Unternehmen übrig geblieben. Dann haben sie untersucht, was die für eine Führungskultur haben. Dabei stell ten sich viele Faktoren heraus und einer war: Es sind Leute, die sich mögen. Wenn man eine gewisse Beziehungssicherheit hat, dann kann man auch über Sachfragen wie „Wie entscheiden wir?“ streiten. In den Aktiengesellschaften, die ich kenne, wird eher das Modell gefördert, dass man Leute sucht, die so ähnlich sind wie man selber, und die Konkurrenz wird großgeschrieben. Mein Vater war im Vorstand eines großen Unternehmens und kam abends nach Hause und sagte: „Heute haben wir wieder gegenseitig an unseren Stühlen gesägt.“ Wir haben eine Studie über Mehrgenerationen-Familienunternehmen gemacht und einer der Leute dort sagte: „Wir suchen die Leute aus, die zu uns in Top-Positionen kommen. Die müssen natürlich schon in ihrem Fach gut sein, aber sie müssen darüber hinaus auch nett und normal sein.“ Das habe ich mir gemerkt: „Nette und normale Leute“, mit denen kann man sich sicher gut auseinandersetzen.
Ulrich P. Hagg: Sie haben vom Unterschied, wie Familien funktionieren und wie Organisationen funktionieren, erzählt und Sie haben viel mit Familienunternehmen zu tun gehabt. Dort treffen ja beide Systeme aufeinander. Wie kann das gelingen? Das ist ja eigentlich ein Widerspruch.
F.S.: Nein, das ist kein Widerspruch, weil es zwei verschiedene soziale Systeme sind: Das Unternehmen auf der einen Seite – da habe ich die hohe Austauschbarkeit – und auf der anderen Seite die Familie – da besteht keine Austauschbarkeit. Was man in erfolgreichen Familienunternehmen sieht, ist, dass diese Systeme ja nicht vermischt sind. Es herrschen in der Familie andere kommunikative Spielregeln als in der Organisation, aber die beiden durchlaufen eine Co-Evolution. Das ist wie eine Paarbeziehung oder wie Herr und Hund, irgendwann sieht das Herrchen aus wie der Hund. In Familienunternehmen ist es häufig so, dass die Unternehmenskultur sich ein Stück der familiären Kultur anpasst, ohne dass die beiden Sachen vermischt werden. Das ist der Erfolgsfaktor für Familienunternehmen. Familienunternehmen sind das erfolg reichste Unternehmensmodell, das es gibt, und auch das am wenigsten erfolgreiche. Es ist hoch ambivalent, entweder sie sind extrem erfolgreich oder es ist ganz schrecklich, wie da gewirtschaftet wird. Aber wenn es gelingt die Beziehung zwischen Familie und Unternehmen zu managen, dann sind sie deshalb so erfolgreich, weil sie die Paradoxie akzeptieren, dass sie zwei verschiedenen Spielregeln gerecht werden müssen, nämlich den familiären beziehungsorientierten und den organisationalen sachorientierten. Familienunternehmen, die erfolgreich sind, entscheiden über diese Paradoxie nicht, sie halten sie aufrecht. Das heißt, sie müssen immer wieder aufs Neue entscheiden: Lassen wir jetzt eher familiäre oder eher Unternehmenskriterien gelten. Aber die meisten Leute denken nicht in Paradoxien. Wenn ich ihn Paradoxien denke, dann sehe ich, dass ich Unentscheidbarkeit herstellen und aufrechterhalten muss, um überhaupt entscheiden zu können. Wie Heinz von Foerster gesagt hat: „Nur die Fragen, die prinzipiell unentscheidbar sind, kann man entscheiden.“ Familienunternehmen haben halt den Vorteil, dass sie jeden Tag mit der Paradoxie konfrontiert sind, während man es in anderen Unternehmen leugnen und drüber weg schauen kann.
U.H.: Also schlampige Verhältnisse?
F.S.: Schlampige Verhältnisse sind etwas wirklich Funktionelles. Weil sie natürlich viel mehr Flexibilität offen lassen. Also ich bin heute aus Venedig gekommen und bis zehn Minuten vor der Abfahrt war der Bahnsteig noch nicht angezeigt. Offensichtlich wird dort der Bahnsteig erst angezeigt, wenn der Zug vor der Tür steht. In Deutschland wird schon anderthalb Jahre vorher gedruckt, welcher Bahnsteig es ist. Ich habe schon oft erlebt, eine Viertelstunde zu warten, weil noch ein anderer Zug auf dem Bahnsteig ist, obwohl vier Bahnsteige frei sind. Aber es ist eben nicht der, der ausgedruckt war. Also insofern sind schlampige Verhältnisse durchaus funktionell.
U.H.: Ich würde gern noch zum Titel dieses Gesprächs zurückkommen. Da stand unter anderem „Rezepte für Kommunikation“ und das hat mich neugierig gemacht, weil ja ein Widerspruch darin besteht, Menschen ihre Selbstorganisationsfähigkeit zu lassen und gleichzeitig „Rezepte“ anzubieten.
F.S.: Ich denke, man muss die Selbstorganisation organisieren und das ist eine Paradoxie. Es passieren ja selbstorganisierte Phänomene wie die Proteste der Gilets Jaunes in Frankreich oder Fridays for Future. Da kommen tausende Leute auf die Straße und demonstrieren, nur hat das keinerlei Konsequenzen, wenn es nicht in eine Organisation mündet. Hier haben Sie eine zum Teil rational und zum Teil emotional gesteuerte Aktivität, warum die Leute auf die Straße gehen, und diese Aufgeregtheit und emotionale Empörung können Sie nicht auf Dauer stellen. Wenn Sie irgendetwas auf Dauer stellen wollen, dann müssen Sie eine Organisation gründen, die dafür sorgt, dass immer wieder irgendetwas passiert, das die Aufmerksamkeit der Menschen weckt. Wie man bei den Gilets Jaunes sieht, ist da nicht mehr viel übrig geblieben ähnlich wie ja auch bei Occupy Wallstreet. So ist das auch im Rahmen von Organisationen, wo immer mehr auf Selbstorganisation gesetzt wird. Wie ich vorhin gesagt habe, müssen Sie ein Team haben, in dem man gemeinsam Entscheidungen trifft, und das muss einer einberufen. Die treffen sich nicht spontan und sagen: „Wir übernehmen den Laden!“ – das funktioniert nicht. Insofern besteht die Paradoxie darin, wenn man Selbstorganisation will, muss man es organisieren. Wenn ich mir den Carl-Auer Verlag anschaue, sitzen da elf oder zwölf Leute und ich bin der Chef. Ich bin aber in Berlin und der Verlag ist in Heidelberg und ich telefoniere zwar täglich, aber nur um ihnen zu sagen, dass ich mich nicht einmische. Man muss also Bedingungen für Selbstorganisation schaffen und das ist eine organisationale Aufgabe.
U.H.: Würden Sie sagen, dass die Arbeiten von Maturana und Varela über die Selbstregulation und Selbstorganisationsfähigkeit neben der luhmannschen Theorie und der Theoriebildung aus Palo Alto für die Systemtheorie einen dritten Strang darstellen?
F.S.: Nein, das ist kein dritter Strang, sondern der gehört zu den beiden, weil das Autopoiese-Modell von Maturana und Varela als integraler Bestandteil dieser beiden Ansätze auf Familien und Organisationen anwendbar ist, zwischen denen ich eigentlich auch keinen Widerspruch erlebe, weil Luhmann sich genauso auf Bateson wie Watzlawick beruft. Luhmann ist radikaler, weil er im Sinne der Autopoiese die Beziehung zwischen psychischen Systemen und sozialen Systemen insofern klarer trennt, dass es autonome voneinander abgeschlossene Systeme sind, was ich sehr praktisch finde. Ich erinnere mich, dass ich in den 80er Jahren einen Workshop für Organisationsberater in Wien gegeben habe und ganz überrascht war, dass die relativ gute Familieninterventionen machten. Und die Erklärung dafür war, dass die schon mehr auf Kommunikationsmuster schauten als die Therapeuten, die in den 80er Jahren noch immer versuchten, vier Psychodynamiken zu verstehen, wenn sie mit vier Leuten zu tun hatten. Wenn ich verstehen will, wie die Psychodynamik des einen mit der Psychodynamik des anderen zusammenhängt, explodiert natürlich die Komplexität. Wie wenn wir jetzt verstehen wollten, was hier passiert, und versuchen wollten die Psychodynamik aller Beteiligten zu analysieren. Das brauchen wir nicht, es reicht zu wissen, irgendeinen wie immer gearteten Grund hat jeder, hier sitzen zu bleiben. Wenn dann alle weg sind, wissen wir, das Thema hat sich aufgelöst. In dem Moment mache ich – wie Luhmann – die Psyche zur Umwelt des Kommunikationssystems, was ich sehr logisch konsistent finde, weil der Körper auch eine Umwelt des sozialen Systems ist. Damit reduziere ich Komplexität in einer Weise, die es auch in der Beratung praktisch handhabbar macht. Neulich waren zwei Musiker bei mir, die schon seit 19 Jahren einen Konflikt hatten. Sie spielen in demselben Orchester und waren schon bei drei Mediatoren, dorthin sind sie vom Orchesterleiter geschickt worden. Ich stelle dann immer die umgekehrte Gute-Fee-Frage: „Stellen Sie sich vor, die gute Fee kommt und Ihr Konflikt ist beseitigt, was müssen Sie tun, damit er wieder aufflackert? Wie würden Sie es wieder anheizen?“ Jeder hat genau gesagt, wie das geht. Um 19 Jahre einen Konflikt aufrechtzuerhalten, muss man den anderen ziemlich gut kennen. Gut, mehr habe ich nicht gemacht. Sie haben mir dann nachher erzählt, wie sie bei mir die Treppe runtergegangen sind und beide „war wieder nix“ gedacht haben, aber unten sich dann in die Arme gefallen sind. Ich habe mich überhaupt nicht für die persönliche Psychodynamik der beiden interessiert, sondern nur das Kommunikationsmuster angeschaut. Mich interessiert, wie es jeder in Zukunft anlegen könnte und was jeder dafür tun kann. Natürlich haben beide ein Vetorecht gegenüber dem Frieden und können jederzeit wieder anfangen. Um wieder auf Maturana und Varela zurückzukommen, so sehe ich eine gute Übereinkunft zu den anderen Modellen. Die waren ja nicht immer einverstanden mit dem, was die Therapeuten damit machten. Aber wenn man ein Modell in die Welt gesetzt hat, entwickelt es sich weiter, ob man es will oder nicht.
Publikum: Was sagen Sie denn als Konstruktivist zum Thema Wahrheit und Täuschung oder Fake News, um es modern zu sagen?
F.S.: Also ich glaube nicht an eine absolute Wahrheit, aber ich habe natürlich meine persönlichen Wahrheiten und ich glaube, es macht Sinn, sich in einem sozialen System über das, was man als Wahrheit definiert, zu einigen. Man kann zwar einen Konsens darüber erzielen, was wahr ist, aber über manche Bereiche eben nicht. Wenn mir jemand erzählen will, wie meine Gefühle sind, dann werde ich das nicht einem sozialen Prozess ausliefern. Aber sich zu fragen: „Waren da nur ein paar hundert Leute bei der Eröffnungsveranstaltung der Präsidentschaft oder waren da Millionen?“, da sind wir auf der Ebene, wo man sich mit Hilfe von Bildern über Beschreibungen einigen kann. Und dann kann man, finde ich, schon sagen: Das ist eine grobe Lüge. Ich hätte da auch als Konstruktivist kein Problem damit, weil nicht alles konstruierbar ist. Manche Leute missverstehen ja den Konstruktivismus, als ob es beliebig wäre, was man konstruiert. Es muss ja irgendwie zu den Phänomenen pas sen, denn wenn ich mir ein Weltbild konstruiere, dass ich fliegen kann, und vom Hochhaus springe, dann merke ich spätestens unten, dass es nicht stimmt. Also fake news.
E.G.: Was wird Ihr nächstes Projekt sein, haben Sie da schon einen Titel?
F.S.: Nein, ich habe üblicherweise keine nächsten Projekte. Wenn ich eine Idee habe, was zu machen, dann fange ich damit an. Ich habe gerade ein Buch, das heißt „Formen“, geschrieben, wo ich das Autopoiese-Konzept auf die Beziehung zwischen Organismus, Psyche und sozialen Systemen angewandt habe. Das habe ich, weil das ein ziemlich weiter Bereich ist, sehr kondensiert, sozusagen wie Nescafé. Ich habe auch niemanden und nichts zitiert und ein Rezensent hat mir das richtig um die Ohren gehauen. Es steht nämlich in meinem Vorwort am Anfang: „Ich zitiere auch niemanden, weil es mir vollkommen egal ist, was andere gedacht haben.“ Nur ist das ironischerweise das einzige Zitat in dem Buch, es stammt nämlich aus der Einleitung vom Tractatus Logicus. Ich habe aber Mitleid mit den Lesern und stelle jetzt nacheinander zu jedem dieser Sätze eine Erklärung und eine Literatur ins Netz – das ist sozusagen ein Projekt, an dem ich gerade dran bin, und wenn ich dann in zehn Jahren damit fertig bin, lasse ich das sicherlich auch drucken. Aber sonst habe ich keine weiteren Projekte, außer gut zu leben.
E.G.: Würden Sie sagen, dass ein guter Therapeut viel Humor braucht?
F.S.: Ich habe in einem meiner Bücher einmal den Schlusssatz geschrieben: Therapie ohne Humor ist witzlos! Das ist ja in der Therapie verpönt, weil manche meinen, man würde seine Patienten nicht ernst nehmen, während wir in Heidelberg damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ich erinnere mich an eine Sitzung, da kam eine Familie rein und wir fragten: „Was führt sie her?“ und der Mann sagte: „Ich habe eine Psychose“ und da fragte mein Kollege: „Haben Sie sie mit?“
Maga Elvira Gross, MAS
email: info@paulwatzlawickgesellschaft.at
Univ.Lekt. Ulrich P. Hagg, MA MBA
email: info@ulrichhagg.at