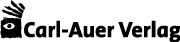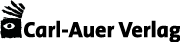Individuum
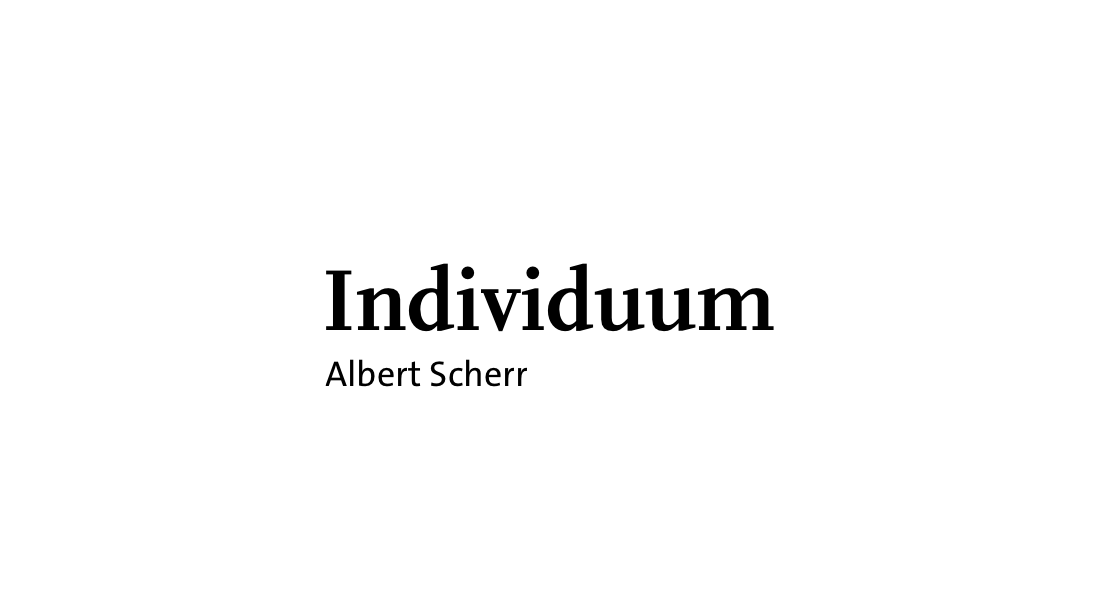
engl. individual, franz. individu m, lat. individuum = »das Unteilbare«. Wenn von Menschen als Individuen die Rede ist, dann wird damit erstens darauf hingewiesen, dass jeder Einzelne Eigenschaften und Merkmale aufweist, die ihn von anderen unterscheiden (Besonderheit), zweitens auf das unteilbare Zusammenwirken von Körper und Psyche (Unteilbarkeit); drittens impliziert die Rede von Individuen die Annahme, dass diese sich selbst von anderen unterscheiden und über Fähigkeiten wie Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion, eigenverantwortliches Denken, Sprechen und Handeln verfügen (Subjektivität).
Systemtheoretische Bestimmungen schließen einerseits an unterschiedliche sozialphilosophische und sozialwissenschaftliche Traditionen an, die sich in der Kritik am Konstrukt des von anderen unabhängigen, autonomen (Autonomie) Individuums entwickelt haben. Individuen treten dort als »Individuen-in-sozialen-Beziehungen« in den Blick, d. h. in ihrem Angewiesensein auf soziale Beziehungen und als Personen, die durch biografische und gegenwärtige soziale Erfahrungen in ihrem Erleben, Denken und Handeln beeinflusst sind. Andererseits grenzt sich die Systemtheorie, insbesondere die Systemtheorie luhmannscher Prägung, jedoch gegen ein zu einfach gefasstes Verständnis des Individuums als sozialen Wesens ab. Betont wird dort zugleich die Differenz zwischen Sozialsystemen und psychischen Systemen.
Für Individuen werden in der klassischen Subjektphilosophie (so etwa bei Immanuel Kant und Georg W. F. Hegel) und daran anschließend in der Soziologie (so etwa bei Georg Simmel) und Sozialpsychologie (so etwa bei George H. Mead) Eigenschaften bzw. Fähigkeiten angenommen, welche die neuere Systemtheorie ganz generell als Kennzeichen von Systemen, von psychischen, aber auch von sozialen Systemen, in Anspruch nimmt: Dem Sichunterscheiden als Grenzziehung zwischen Ich und Nichtich entspricht die Grenzziehung zwischen System und Umwelt, der Selbstwahrnehmung und dem Selbstbewusstsein entspricht die systemische Selbstreferenz. Und an die Stelle der älteren subjektphilosophischen Begriffe der Autonomie und Selbstbestimmungsfähigkeit tritt in der Systemtheorie ein Verständnis von Individuen als nichttrivialen Systemen: Nichttriviale Systeme sind dadurch gekennzeichnet, dass ein externer Impuls nicht zu einer eindeutig vorbestimmten und immer gleichen Reaktion führt; sie verfügen über komplexe (Komplexität) Möglichkeiten der internen Verarbeitung von Informationen (s. dazu von Foerster 2001, S. 160 ff.); sie können »so viele Zustände annehmen, dass sie nicht berechnet werden können und ihr Verhalten nicht prognostiziert werden kann« (Luhmann 1995, S. 68). Entsprechend weist Luhmann (1996, S. 52) darauf hin, dass die Systemtheorie als »Theorie selbstreferenzieller, nichttrivialer [...] Systeme, die sich von der Umwelt abgrenzen müssen«, erhebliche Übereinstimmung mit älteren Subjekttheorien aufweist und eine Leistung der soziologischen Systemtheorie darin besteht, »diesen so vielversprechenden Theorietypus vom ›Subjekt‹ auf das ›Sozialsystem Gesellschaft‹ zu übertragen« (ebd., S. 53; Gesellschaft).
Die Systemtheorie kann jedoch keineswegs einfach als Fortsetzung und Verallgemeinerung klassischer sozialphilosophischer und soziolgischer Bestimmungen des Individuums verstanden werden. Vielmehr setzt sie sich auch – dies in komplexer und keineswegs unumstrittener Weise – in Distanz zu ihnen (s. dazu insbesondere Luhmann 1997, S. 1016 ff.; Scherr 2002). Infrage gestellt wird u. a. der tradierte Identitätsbegriff:
»Das Individuum wird durch Teilbarkeit definiert. Es benötigt ein musikalisches Selbst für die Oper, ein strebsames Selbst für den Beruf, ein geduldiges Selbst für die Familie. Was ihm für sich selbst bleibt, ist das Problem seiner Identität« (Luhmann 1993, S. 223).
Sozialwissenschaftliche Theorien unterschiedlicher Ausrichtung haben darauf hingewiesen, dass Individuen keine Monaden sind, die unabhängig von sozialen Beziehungen existieren. Gegen den Individualismus der frühbürgerlichen Sozialtheorien hatte bereits Karl Marx darauf verwiesen, dass Menschen als soziale Wesen zu begreifen sind, die »nur in der Gesellschaft sich vereinzeln können« (Marx 1858, S. 6). Die Entwicklung des Einzelnen zum eigenständigen, handlungsfähigen Individuum sei außerhalb gesellschaftlicher Beziehungen ebenso wenig vorstellbar, wie »Sprachentwicklung ohne zusammen lebende und sprechende Individuen« (ebd.). In der Sozialpsychologie George Herbert Meads (Mead 1968) wurde aufgezeigt, dass und wie sich das Selbst in sozialen Kooperationsbeziehungen entwickelt. Auch aus der Perspektive einer intersubjektivitätstheoretisch informierten Psychoanalyse wird argumentiert, dass der Mensch nur »durch soziale Beziehungen ein Verhältnis zu sich selbst und zur Welt gewinnt« und dass »wir gerade dadurch zu einzigartigen, unverwechselbaren Individuen werden, dass wir unsere ›Beziehungsschicksale‹ verinnerlichen und zum Aufbau unserer psychischen Struktur verwenden« (Altmeyer u. Thomä 2006, S. 8). Norbert Elias stellt in seiner Figurationssoziologie die Vorstellung des aus seinen sozialen Beziehungen analytisch herauslösbaren und in sich abgeschlossenen Individuums konsequent infrage; an dessen Stelle tritt bei ihm ein Modell, das von der Annahme ausgeht, dass »der Mensch [...] ein Prozess« ist (Elias 1986, S. 127), der sich mit und in den sozialen Beziehungen, in denen er sich vorfindet, verändert.
In Übereinstimmung damit gehen systemtheoretische Betrachtungen nicht vom Individuum aus, sondern von sozialen Strukturen und Prozessen. Gregory Bateson stellt in seiner Ökologie des Geistes (1985) die Struktur sozialer Beziehungsmuster und ihre Auswirkungen auf die psychische Entwicklung ins Zentrum; in ähnlicher Weise verschieben Paul Watzlawick, Janet H. Beavin und Don D. Jackson (1969, S. 22) den Fokus der Betrachtung: »Die Psychologie hat in ihrer langen Geschichte stets einen starken Hang zur monadischen Auffassung vom Menschen gezeigt und daher zur Reifikation (Verdinglichung) dessen, was sich nun mehr und mehr als komplexe Strukturen von Beziehungen und Wechselwirkungen erweist.« In Übereinstimmung damit werden in Konzepten der systemischen Therapie individuelle Symptomatiken als Ausdruck gestörter sozialer Beziehungen betrachtet (Symptomträger), nicht, wie in der medizinisch-naturwissenschaftlich orientierten Psychologie, als Folge von Dispositionen, die im Individuum angelegt sind (s. Simon u. Rech-Simon 2000). Systemische Sichtweisen stellen damit das Postulat infrage, dass Aussagen über Individuen zulässig sind, die ihnen unabhängig von ihren sozialen Einbettungen gegebene Eigenschaften (etwa: Bedürfnisse, Verhaltensmuster) zuschreiben.
Eine andere, deutlich anders gelagerte Akzentuierung nimmt die soziologische Systemtheorie Niklas Luhmanns vor. Dort wird die Differenz zwischen sozialen und psychischen Systemen akzentuiert, und Individualität wird sozialtheoretisch als »Exklusionsindividualität« (Luhmann 1993, S. 154 ff.; Exklusion) bestimmt. Damit wird nun keineswegs generell bestritten, dass Individuen ihr Leben in sozialen Zusammenhängen führen und dadurch in ihrem Erleben, Denken und Handeln beeinflusst sind, und auch nicht, dass soziale Prozesse auf die Mitwirkung von Individuen an Kommunikation angewiesen sind. Betont wird jedoch, dass Sozialsysteme einerseits, psychische Systeme andererseits jeweils autopoietisch operieren (Autopoiesis) und soziale Kommunikationsprozesse einerseits, individuelle Bewusstseinsprozesse andererseits nicht ineinander aufgehen und auch nicht kausal miteinander verknüpft sind. Die zugrunde liegende Annahme kann, grob vereinfacht, wie folgt zusammengefasst werden: Kein Individuum kann und muss alles, was in seinem Kopf vorgeht, der sozialen Kommunikation zur Verfügung stellen, und Kommunikation ist nicht in der Lage, das Erleben und Denken von Individuen umfassend aufzugreifen. Soziale Kommunikation und individuelles Bewusstsein sind strukturell gekoppelt (Kopplung), irritieren (Irritation) sich wechselseitig. Hierfür sind die Eigenschaften des Mediums Sprache, das Medium sowohl des Denkens als auch der Kommunikation ist, von zentraler Bedeutung.
Pädagogische und psychotherapeutische Interventionen sind – so das traditionelle Selbstverständnis – darauf ausgerichtet (Ziel), das Erleben, Denken und Handeln von Individuen zu verändern. Dabei sind Konzepte einflussreich, die auf Trivialisierung zielen: Ihre ärgerliche Unberechenbarkeit soll den Individuen durch Erziehung und Therapie ausgetrieben werden, aus Subjekten sollen Trivialmaschinen werden, deren Verhalten steuerbar und vorhersagbar ist. Systemische Konzepte nehmen demgegenüber drei Verschiebungen vor:
a) Als Interventionsort werden soziale Beziehungen bzw. kommunikative Prozesse konzipiert, in die Individuen involviert sind.
b) Es wird davon ausgegangen, dass soziale und psychische Prozesse durch pädagogische und therapeutische Interventionen zwar beeinflussbar sind, dass diese Beeinflussung aber nicht nach dem Modell eindeutiger Ursache-Wirkungs-Beziehungen gedacht werden kann.
c) Veränderungen von Individuen sind als Selbstveränderungen psychischer Systeme zu denken, die angeregt, unterstützt und ermöglicht werden, aber nicht durch externe Einwirkungen gezielt herbeigeführt werden können.
Fritz B. Simon weist darauf hin, dass keineswegs von einer angemessenen Übersetzung systemtheoretischer Konzepte in praktische Handlungskonzepte ausgegangen werden kann. Festzustellen sei vielmehr, dass abstrakte und komplexe Systemtheorien vielfach »zur Entwicklung relativ simpler, pragmatischer therapeutischer Methoden genutzt werden« (2000, S. 373). Demgegenüber fordert er dazu auf, eine gesellschaftstheoretisch fundierte »Theorie der Therapie« (ebd.) auf der Grundlage der luhmannschen Systemtheorie zu entwickeln.
Verwendete Literatur
Bateson, Gregory (1985): Ökologie des Geistes. Frankfurt a. M. (Suhrkamp).
Elias, Norbert (1986): Was ist Soziologie? Weinheim/München (Juventa).
Foerster, Heinz von (2001): Short Cuts. Frankfurt a. M. (Zweitausendeins).
Luhmann, Niklas (1996): Die neuzeitlichen Wissenschaften und die Phänomenologie. Wien (Picus).
Luhmann, Niklas (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M. (Suhrkamp).
Marx, Karl (1858): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Frankfurt a. M. (Rohentwurf).
Scherr, Albert (2002): Soziologische Systemtheorie als Grundlage einer Theorie der Sozialen Arbeit? Neue Praxis 3: 258–267.
Weiterführende Literatur
Baecker, Dirk (2005): Kommunikation. Leipzig (Reclam).