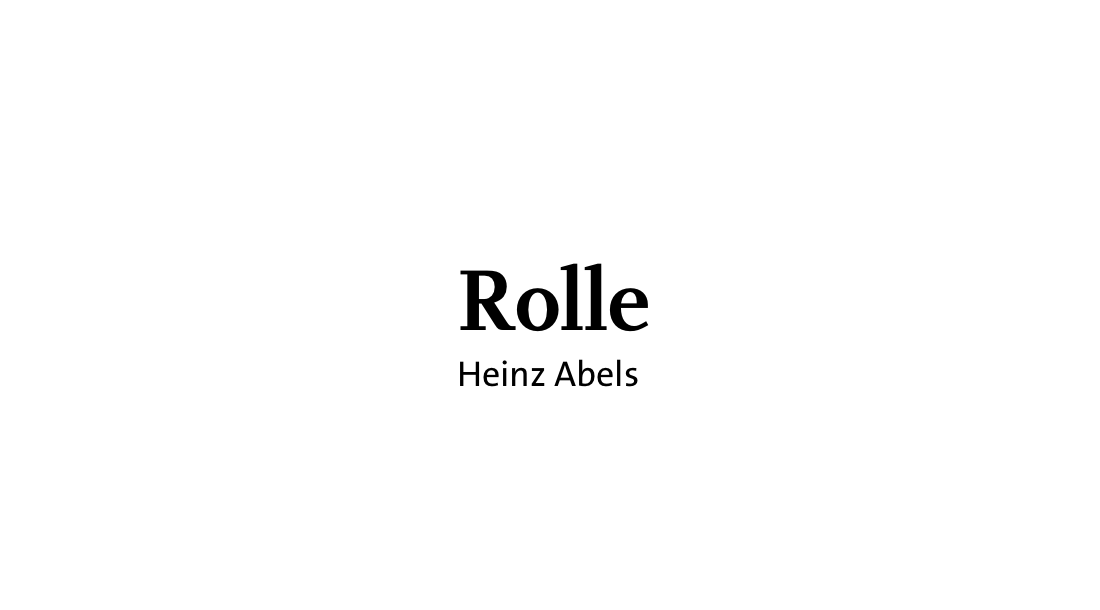Leitbild

engl. mission statement, franz. énoncé de mission; Leitbilder sind nach außen und innen verkündete Wertekataloge. Werte – man denke dabei an Formulierungen wie beispielsweise »Wir schützen unsere Umwelt«, »Wir sind behindertenfreundlich«, »Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital« oder »Bei uns ist der Kunde König« – stellen zwar Verhaltenserwartungen dar, sie lassen aber offen, welche Handlungen in einer konkreten Situation erwartet werden können. Wegen ihrer Abstraktheit haben Werte zwar »hohe Konsenschancen« (Luhmann 1972, S. 88 f.), aber sie stecken gleichzeitig letztlich voller praktischer Widersprüche. Wie weit soll man beim Schutz »unserer Umwelt« gehen? Darf man dafür im Notfall auch töten? Wie soll man sich verhalten, wenn eine Maßnahme zwar dem »Kunden König« nutzt, aber den Mitarbeitenden – dem »wichtigsten Kapital« des Unternehmens – schadet? Werte unterscheiden sich grundlegend von Programmen. Programme sind Regeln für das richtige Entscheiden. Sie können in Form von Strategien daherkommen – zum Beispiel in der Übereinkunft, bis zum Jahresende 15 % neue Kunden oder Kundinnen zu gewinnen oder den Umsatz um 10 % zu steigern. Der Clou bei Programmen ist, dass – anders als bei Werten – vergleichsweise sicher identifiziert werden kann, ob im Sinne eines Programmes richtig gehandelt wurde oder nicht. Ob in einem Jahr 15 % neue Kunden oder Kundinnen gewonnen wurden oder der Umsatz um 10 % gesteigert werden konnte, lässt sich eindeutig feststellen; ob der Kunde immer wie ein König behandelt wurde, ist offen für vielfältige Interpretationen (siehe dazu Zollondz 2001).
Die große Schwäche von den in Leitbildern abgelegten Wertekatalogen ist deswegen, dass sie sich nicht zur Formulierung konkreter formaler Erwartungen an Organisationsmitglieder eignen. Bei formalen Erwartungen handelt es sich um die Erwartungen, die ein Organisationsmitglied erfüllen muss, um weiterhin Mitglied einer Organisation bleiben zu können. Über die formalen Erwartungen wird spezifiziert, von wann bis wann man in der Organisation anwesend zu sein hat. Es wird festgelegt, was während der Anwesenheit zu tun ist, auf welche anderen Organisationsmitglieder man zu achten hat und welche man ignorieren kann. Wenn man nicht bereit ist, sich an diese formalen Erwartungen zu halten, dann kann man nicht Mitglied der Organisation bleiben.
Das Management setzt nicht selten besondere Hoffnung darauf, über Leitbildprozesse auf die Organisationskultur – die informalen Strukturen – eines Unternehmens, einer Verwaltung, eines Krankenhauses oder einer Schule einzuwirken. Der Prozess zur Formulierung eines Leitbildes lässt einen alten Wunschtraum des Managements wieder aufleben: Man hofft, damit die informellen Netzwerke, die verdeckten Anreizstrukturen und impliziten Denkschemata so gestalten zu können, dass sie im Sinne des Unternehmens wirken. Ein Leitbild als gestaltbarer Erfolgsfaktor soll die »weichen Faktoren« der Organisationskultur in den Griff bekommen. Der Erfolg eines Unternehmens, einer Verwaltung oder einer Universität hänge nicht, so die These, vorrangig von deren formaler Organisationsstruktur, sondern von der Kultur ab, und diese lasse sich durch Leitbildprozesse beeinflussen. Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass sich die Organisationskultur – in den informalen Strukturen – dem direkten Zugriff des Managements entzieht. Informal sind all jene Erwartungen in der Organisation, die nicht mit Bezug auf die Mitgliedschaftsbedingungen formuliert werden (oder werden können). Eine Chefin kann informelle Erwartungen – beispielsweise länger als die gesetzliche Arbeitszeit zu arbeiten – an ihre Mitarbeitenden herantragen, eine Abmahnung mit der Begründung, ihre informellen Erwartungen an eine Untergebene seien nicht erfüllt worden, kann sie jedoch bei Nichtbefolgen nicht aussprechen. Jede Rechtsabteilung einer Verwaltung, jedes Militärgericht einer Armee und jedes Schiedsgericht einer Partei würde einen Prozess verlieren, wenn es zugeben müsste, dass ein Mitarbeiter zwar gegen informelle Erwartungen der Organisation verstoßen habe, formal aber richtig gehandelt habe.
Im klassischen – durch ein Maschinenverständnis von Organisationen geprägten – Paradigma der Leitbildentwicklung wurde das Leitbild über Jahre als Ausgangspunkt für alle weiteren Entscheidungen angesehen (siehe dazu zum Beispiel Heinrich u. Spengler 2007). Man beginne, so die lange Zeit vorgeschlagene Standardvorgehensweise, mit der Formulierung einer Vision als einer grundsätzlich gehaltenen Vorstellung von der künftigen Rolle der Organisation. Diese Vision sollte dann in einem Leitbild, in dem auch Auskunft über die Werte der Organisation gegeben wird, spezifiziert werden. Erst auf der Basis dieses Leitbildes sollten in einem kaskadenartigen Prozess strategische Ziele formuliert werden. Die Kaskade sollte mit einer Liste von Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie abschließen und die Leitbilder sollten so in die Kultur einer Organisation einsickern. Jede höhere Stufe, so die Vorstellung, liefere der nächsttieferen Orientierungen und setze »Planken«, innerhalb derer man sich auf der nächsttieferen Stufe bewegen könne.
Auf den ersten Blick hat diese Vorgehensweise Charme, weil sie ein hohes Maß an organisatorischer Stringenz suggeriert. Wie in einer Maschine, so die Vorstellung des Managements, greifen die verschiedenen Prozesse in der Organisation ineinander. Resultat ist eine stromlinienförmige Organisation, in der alle Elemente konsistent aufeinander bezogen sind. Mit diesem Modell werden gerade die Steuerungshoffnungen von Topmanagern und Topmanagerinnen befriedigt, denen das Kaskadenmodell die Illusion vermittelt, dass sich im Prinzip alle Entscheidungen in einer Organisation aus grundlegenden Überlegungen ableiten lassen.
Die organisatorische Realität sieht jedoch grundlegend anders aus. Nicht selten werden in Organisationen zunächst strategische Stoßrichtungen bestimmt und erst dann ausgearbeitet. Danach werden Leitbilder und Visionen formuliert, um dem Ganzen den Eindruck einer durchgängigen Logik zu geben. Oftmals initiieren innovative Mitarbeitende Praktiken, durch die Perspektiven für neue Strategien überhaupt erst eröffnet werden. Die Visionen entwickeln sich dann erst aufgrund von diesen von unten eingeführten Praktiken. Manchmal werden Strategien und Leitbilder auch weitgehend unabhängig voneinander vorangetrieben und durch ganz unterschiedliche Akteure in der Organisation entwickelt. Sie sind dann, um die Sprache der neuen Organisationsforschung zu nutzen, nur lose miteinander gekoppelt (Weick 1976).
Aus einer systemtheoretischen (System) Perspektive ist es in Leitbildprozessen nicht sinnvoll, die Realität der Organisation immer wieder mit der Illusion eines reinen Kaskadenmodells zu konfrontieren; man sollte vielmehr das Phänomen der nur losen Kopplung von Leitbild- und Strategieentwicklung nutzen. Die Leitbildarbeit setzt dabei auf einer abstrakten Stufe an. Es wird – weitgehend befreit von der bitteren organisatorischen Realität – mit Missionen, Visionen und Werten der Organisation gearbeitet. Der Strategieentwicklungsprozess wird dagegen, nur lose gekoppelt, auf zentrale Entscheidungen der Organisation hin zugespitzt.
Häufig kommt das fertiggestellte Leitbild als Hochglanzbroschüre daher. Es gibt gute Gründe für die Hochglanzbroschüren, die in Stein gemeißelten oder prominent als Pop-up auf der Website erscheinenden Leitbilder: Sie suggerieren Beständigkeit. Es wird darüber signalisiert, dass es sich nicht um eine »Vision der Woche«, einen »Wert des Monats« oder ein »Leitbild als Jahreslosung« handelt, sondern um eine Aussage, auf die sich eine Organisation auch langfristig verpflichtet.
Häufig entstehen aber gerade durch die in Stein gemeißelten Leitbilder, die gedruckten Poster und die Hochglanzbroschüren Konsistenzprobleme. In nicht wenigen Unternehmen begegnen uns Leitbilder, die über Poster verkündet werden, deren Ausrichtung aber häufig nicht mehr en vogue ist. Diese manifestierten veralteten oder abgenutzten Leitbilder bleiben einfach hängen, weil sich niemand dafür zuständig fühlt, sie gegen die neuen Exemplare auszutauschen. Aus einer systemtheoretisch aufgeklärten Perspektive ist es sinnvoller, sich mehr auf den Prozess der Erstellung zu konzentrieren und weniger auf das fertige Leitbildprodukt. Die Verständigung über einen Wertekatalog zwischen Management und Mitarbeitenden erfolgt im Prozess der Erstellung des Leitbildes und nicht im Moment der Präsentation. Es ist der mühsame Prozess der Erarbeitung des Leitbildes, in dem die Prinzipien nicht nur präzisiert, sondern auch in der Organisation verbreitet werden. Um es mit einem abgegriffenen Spruch zu sagen: Bei der Leitbilderstellung ist der Weg das Ziel.
Als Faustregel gilt in althergebrachten Leitbildprozessen das »80-20-Prinzip«. Im klassischen Leitbildprozess werden 20 % des Budgets, der für diesen Prozess reservierten Arbeitszeit des Managements, der Stabsstellen und der externen Dienstleister für die Phase der Sondierung und der Erstellung des Leitbildes aufgebracht. 80 % des Budgets werden ausgegeben, nachdem das Leitbild steht – für das genaue Wording, für den Entwurf der Image-Broschüre, das Drucken, die Durchführung von Verkündigungsevents und die Organisation von Folgeveranstaltungen, in denen das Management mit den Mitarbeitenden zum Beispiel in Mittagsrunden darüber diskutiert, wie die Prinzipien des Leitbildes eingehalten werden. Bei der hier vorgestellten Vorgehensweise werden die eigentlichen Effekte jedoch in der Sondierung und Erarbeitung des Leitbildes und in der Diskussion der ersten Entwürfe erzielt. Dementsprechend werden 80 % des Budgets und besonders der hierfür veranschlagten Arbeitszeit des Managements, Stabsstellen und externen Dienstleister in diese Phase investiert. Maximal 20 % der Zeit des Managements, des Budgets und des Aufwandes für externe Dienstleister werden dann – wenn überhaupt – noch nach der Fertigstellung des Leitbildes benötigt.
Damit dieses »80-20-Prinzip« funktioniert, ist es erforderlich, dass das Management im Rahmen der »80 %« ein schon sehr weitgehend ausgearbeitetes Leitbild zur Diskussion stellt. Natürlich könnte man auch erst das Leitbild erstellen und es anschließend durch die Führungskräfte in einem breiten Roll-out den Mitarbeitenden verkünden lassen. Damit beraubt man sich aber der Chance, den Wertekatalog mit den Mitarbeitenden diskutieren zu können, weil es ja nur noch um Information geht und kritische Einwände oder sinnvolle Anregungen der Mitarbeitenden folgenlos bleiben. Um diese Vorgehensweise noch zuzuspitzen: Wenn es nach der Erstellung des Leitbildes notwendig ist, einen aufwändigen Prozess aufzulegen, um die Leitbilder den Mitarbeitenden zu verkünden, dann ist bei der Erarbeitung des Wertekataloges etwas falsch gemacht worden (siehe dazu Kühl et al. 2015).
Verwendete Literatur
Heinrich, Mark u. Gerrit Spengler (2007): Wozu Leitbilder? Wie durch ein Leitbild die gemeinsame Ausrichtung in Organisationen gefördert werden kann. Organisationsentwicklung 2: 14–21.
Kühl, Stefan, Hansjörg Mauch u. Christoph Nahrholdt (2015): Leitbilder richtig entwickeln. HarvardBusinessManager 10: 56–65.
Luhmann, Niklas (1972): Rechtssoziologie. Reinbek (Rowohlt).
Weick, Karl E. (1976): Educational Organizations as Loosely Coupled Systems. Administrative Science Quarterly 21: 1–19.
Weiterführende Literatur