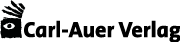Diagnose Krebs – die Rolle der Reisebegleiter

Dieser Artikel ist zuerst erschienen in: momentum 3/2020
Ich bin 2015 an Brustkrebs erkrankt und habe im Rahmen meiner Genesung ein gutes Jahr Therapiezeit durchlaufen, meinen Genesungsprozess aktiv mitgestaltet und eine große persönliche Lernerfahrung gemacht. Ich habe nach meiner eigenen Genesungsreise das Buch „Reiseführer für eine ungeplante Reise – Diagnose Krebs“ geschrieben. Es war nie mein Ziel oder Wunsch, ein Buch zu schreiben. Dies ergab sich zufällig mit der Zeit, und so entstand eine Mischung aus Erfahrungsbericht und Ideen mit Reisetipps und Reflexionsangeboten für die Gestaltung der eigenen Therapiereise. Ich wählte intuitiv die Reisemetapher, um zum einen Leichtigkeit, aber auch Struktur in dieses unvorhersehbare Lebensereignis zu bringen. Eines der Kapitel widmete ich der Rolle der Reisebegleiter*innen – sowohl aus Sicht der Betroffenen als auch aus Sicht der Helfer*innen. Denn für beide ist die Diagnose Krebs ein ungeplantes Ereignis, das von einem Tag auf den anderen vieles im Leben verändert. An dieser Stelle möchte ich in Anlehnung an dieses Kapitel einige Erfahrungen und Ideen aus der Perspektive der Betroffenen teilen, die für Sie, liebe Leserinnen und Leser, als Anregung dienen sollen.
Ein kraftvoller Einsatz von Begleitpersonen kann in fordernden Lebenssituationen nötig sein – insbesondere bei Pflegebedürftigkeit. Im Folgenden beziehe ich mich jedoch auf Situationen, in denen die Betroffenen bis zum Zeitpunkt ihrer Diagnose als „gesund“ galten. Sie können im Genesungsprozess selbstständig agieren und sind nicht auf die allumfassende Hilfe und Betreuung von Außenstehenden angewiesen.
Ich war anfangs irritiert davon, dass einige Menschen in meinem Umfeld von meiner Diagnose so sehr betroffen waren und ihr Verhalten mir gegenüber in meiner Wahrnehmung änderten. Denn ich war doch diejenige, die die Krebsdiagnose hatte. So gab es unterschiedlichste Reaktionsmuster, angefangen von vorsichtigen Nachfragen nach meinem Befinden bis hin zu großer Angst und Distanz, aber auch einem ganz natürlichen Umgang mit mir. Die Krankheit war plötzlich nah ins Umfeld und die Familie vorgerückt und dadurch für alle greifbarer als bei fremden Menschen, entfernten Verwandten oder anonymen Berichten aus den Medien.
Es hat eine Weile gedauert, bis ich begriff, dass diese Krankheit eine große Auswirkung hat, ähnlich wie ein externer Besucher auf eingespielte Beziehungsmuster (Familie, Freund*innen oder Kolleg*innen). So lernte ich relativ schnell, gut für mich zu sorgen. Ich konzentrierte mich auf nützliche und ressourcenstärkende Helfer*innen und hielt andere auf Distanz. Dies war auch meine erste und wichtigste Lernkurve im Genesungsprozess, nämlich ab nun gut auf mich zu achten. Menschen, die gerne für andere da sind und sich selbst eher zurückzunehmen, dürfen spätestens ab dem Zeitpunkt der Diagnose umdenken und ihre gelernten Konditionierungen: „Hauptsache, allen anderen geht es gut“, hinterfragen und ablegen. Auch im „gesunden Zustand“ ist diese Haltung kein nützliches, sondern für einen selbst häufig ein energieraubendes Verhaltensmuster. Die eigenen Wünsche dürfen immer sein, nicht nur, wenn man krank ist. Dies hat nichts mit Egoismus, sondern vielmehr mit guter Selbstfürsorge und mit einem klaren Ja zu den eigenen Bedürfnissen zu tun. Im Falle einer Krebsdiagnose sowie während der Therapiezeit können sich die Bedürfnisse ändern und dürfen immer wieder nachjustiert werden.
Ich habe in dieser Zeit gelernt, ob und wem ich überhaupt von meiner Diagnose erzählen möchte. Es gibt nie ein Richtig oder Falsch, sondern nur das, was sich für einen selbst gut anfühlt. Als ich spürte, wie viel Angst das Thema Krebs bei anderen auslöste, entschied ich mich, recht dosiert mit der Information umzugehen. Denn ich fühlte mich überfordert, mich mit der Angst und den Gefühlen meines Gegenübers auseinanderzusetzen, und mich bewegte es häufig sehr, wenn andere betroffen und traurig auf meine Diagnose reagierten. Ich fühlte mich damals noch sehr stark mitverantwortlich für das Wohl der anderen (meine gelernten Konditionierungen meldeten sich). Darüber hinaus akzeptierte ich meine Erkrankung schnell und richtete meinen Blick kraftvoll nach vorne. Ich wählte bewusst. Ich konnte Gespräche meiden, die mir zu dem Zeitpunkt eher Energie geraubt hätten. Ich kenne andere Frauen, die ganz anders mit ihrer Diagnose umgegangen sind und genau das Gegenteil von mir taten. Diesen ging es damit gut. Und nur darum geht es. Im Nachfolgenden möchte ich Erfahrungen und Ideen in Anlehnung an mein Buch nach Helfergruppen mit Ihnen teilen.
Die Familie
Vermutlich ist es für viele eine der schwierigsten Aufgaben, die eigene Familie (Eltern, die eigenen Kinder, Geschwister) zu informieren. Die Familie fühlt sich häufig sehr hilflos, spürt ihre Ängste vor Verlust und reagiert oft mit großer Sorge. In manchen Fällen übernehmen Familienmitglieder auch ungefragt die Rolle der Entscheider, denn sie glauben, sie müssten nun Verantwortung tragen. Hier zeigen sich eingespielte und gewohnte Rollen. Es ist an der Zeit, sie zu unterbrechen, sofern sie nicht mehr hilfreich sind. Denn die betroffene Person braucht ihre Kraft nun für sich, statt die Ängste und Sorgen der Familienmitglieder aufzufangen. Und sie darf und muss sogar selbst entscheiden. Denn keiner kann stellvertretend diese Reise für die Betroffenen antreten, so gut das auch gemeint sein mag. Ich hatte damals große Angst davor, meine Familie zu informieren, denn ich ahnte, dass mir vor allem meine Eltern mit viel Traurigkeit, Hilflosigkeit und Furcht begegnen könnten. So folgte ich einem Rat einer lieben Freundin, die selbst einige Jahre vor mir erkrankt war, und beauftragte meinen Lebenspartner mit der Übermittlung der Information über meine Diagnose. Ich bin so dankbar, dass er diese Aufgabe in den ersten Tagen nach der Diagnose ganz selbstverständlich übernommen hat. Ich nutzte noch eine Weile zum Sortieren, bevor ich mich dann selbst mit meiner Familie austauschen konnte.
In dieser Situation kann es sehr hilfreich sein, der Familie nützliche Aufgaben zu geben, die für die Erkrankten entlastend sind. Damit ist beiden Seiten geholfen. Die Familie fühlt sich gebraucht und kann unterstützen. Das Gefühl der Hilflosigkeit schwindet. Meine Schwester spendierte mir damals meine tolle, neu frisierte Perücke. Diese nutzte ich zwar nicht, das wusste ich zu Beginn des Prozesses aber nicht. Die Perücke jederzeit zur Hand zu haben, war enorm beruhigend und sehr hilfreich für mich. Meine Eltern kochten für mich Vorräte, und die Familie unterstützte mich später finanziell bei meiner selbst organisierten „Reha-Reise“, die ich bewusst nach Bali antrat. Vor allem Menschen, die gewohnt sind zu geben, dürfen in diesem Prozess lernen, Unterstützung anzunehmen, die Seiten sozusagen zu wechseln und auch nach Hilfe zu fragen. Auch das kann ein wichtiger Lernprozess für viele Betroffene sein. Rückblickend haben wir als Familie miteinander sehr viel gelernt – während und auch nach dieser besonderen Reise.
Freunde und Bekannte
Menschen reagieren jeweils auf ihre eigene Weise auf ungeplante Ereignisse in ihrem Umfeld, denn wir sind nun mal verschieden. Ich habe schnell gelernt, dass das Umfeld die Unterstützung der Betroffenen benötigt. Viele möchten gerne unterstützen, ihre Hilfe anbieten, wissen aber nicht so genau, wie sie das tun sollen. Jeder ist in seinem Denksystem unterwegs; manche glauben, dass sie die betroffene Person stören, und ziehen sich deshalb lieber zurück. Andere wiederum denken, dass sie ständig anrufen sollten oder sich irgendwie besonders aufmerksam verhalten müssten. Deshalb ist es wichtig, dem Umfeld zu sagen, was man als betroffene Person gerade braucht und was nicht, um Missverständnisse zu vermeiden. So habe ich in meinem Freundeskreis direkt am Anfang gesagt, dass ich gerne ganz „normal“ wie vorher behandelt werden möchte. Ich ging zu Hochzeiten und Geburtstagen, und jeder hatte Verständnis, wenn ich nicht die komplette Zeit teilnehmen konnte oder mich früh zurückzog. Je ehrlicher wir mit uns selbst und den anderen sind, umso leichter ist es für alle miteinander.
Das berufliche Umfeld
Die berufliche Situation entscheidet mit darüber, wie viele Betroffene von ihrer Diagnose erzählen oder nicht. Im Angestelltenverhältnis ist bereits die formale Krankschreibung erforderlich, um den Arbeitgeber und die näheren Kolleg*innen zu informieren. Als damals freiberufliche Beraterin und Coach entschied ich mich, mein berufliches Umfeld, also meine Auftraggeber*innen und Kund*innen, zunächst nicht zu informieren. Ich haderte anfangs damit, da ich das Gefühl hatte, in dem Moment nicht ehrlich zu sein. Eine Freundin half mir, diese Perspektive zu verändern. Denn ich fühlte mich eine ganze Weile arbeitsfähig, und ich konnte reduziert kleinere Aufträge annehmen. Da mich die Kund*innen damals aufgrund von Tagesworkshops ohnehin nicht kannten, waren zu dem Zeitpunkt meine kürzeren Haare kein Anlass für Fragen. Mit fortschreitender Therapiezeit lernte ich, dass meine Energieverfügbarkeit schwankte, sodass ich nach einigen Monaten meine Auftraggeber informierte, um rechtzeitig für Planungssicherheit sorgen zu können. Ich nahm zu dem Zeitpunkt keine weiteren Aufträge an, zumal sie häufig mit Reisetätigkeit verbunden waren. Ich bin auf viel Verständnis gestoßen, auch für die Wahl meines Informationszeitpunkts. Das vorherige Hadern hatte nur etwas mit mir zu tun.
All das, was Betroffenen guttut, ist die beste Wahl. Die Entscheidungen hängen von vielen Faktoren ab: der Schwere der Erkrankung, dem Genesungsverlauf, der beruflichen und privaten Situation. Ehrlichkeit zahlte sich für mich immer aus. Ich versteckte mich nicht, vielmehr entschied ich mich bewusst, im Reiseverlauf zu agieren. Für all diejenigen, die im Anstellungsverhältnis sind, gibt es ebenso Möglichkeiten, die eigenen Wünsche zu äußern. Eine Freundin erzählte mir von einer Kollegin, die an Krebs erkrankt war und komplett während ihrer Therapiezeit weiterarbeitete. Dabei bat sie ihr Umfeld, sich mit sorgenvollen Kommentaren zurückzuhalten, und wünschte sich, als „gesund“ betrachtet zu werden. Andere Betroffene wiederum möchten im beruflichen Umfeld über sich und ihre Situation nicht sprechen, auch nach einer Rückkehr in den Berufsalltag. All das darf sein.
Reisetipp
Es ist wichtig, sorgsam zwischen Energieräubern und Kraftspendern auszuwählen. Wir haben immer die Wahl, wen wir während der Genesungsreise in unseren Reisebus einsteigen oder gegebenenfalls auch wieder aussteigen lassen – wie allgemein im Leben. Dabei geht es auch um ein respektvolles Miteinander, denn die Helfer sind und können nicht verantwortlich sein für das Befinden der Betroffenen, das im Reiseprozess stark schwanken kann. Idealerweise sollten wir uns selbst das geben, was wir uns von anderen wünschen.
Ein Mehr an Aufmerksamkeit, ein Mehr an Mitgefühl, ein Mehr an Selbstliebe. Wenn wir es uns selbst geben oder mindestens zugestehen können, geraten wir mit anderen nicht in Abhängigkeitsspiralen und vermeiden enttäuschte Erwartungen. Letzteres lernte ich nochmals besonders während und auch nach meiner Therapiereise. Es hängt an uns selbst, unsere Bedürfnisse uns gegenüber klar zu haben, zu äußern, unser Umfeld mitzugestalten und um Unterstützung zu bitten. Dies gilt für Reisebegleiter ebenso wie für Betroffene. Auch Reisebegleiter*innen dürfen und sollten achtsam mit sich sein, ihre Bedürfnisse und ihre Energieverfügbarkeit prüfen und regelmäßig anpassen. Reisebegleiter*innen benötigen häufig in den verschiedenen Reiseetappen mehr Unterstützung als die Betroffenen selbst und dürfen Beratungs- und Unterstützungsangebote jederzeit für sich nutzen. Es ist für alle eine ungeplante Reise.
Ich wünsche Ihnen miteinander viel Reiseglück und wertvolle Lernerfahrungen.