Eigensprache und Körper Teil 4

Es handelt sich beim folgenden Text um Ausschnitte eines Transkripts eines Webinars zum Thema „Idiolektik und Körpersprache“.
„Nein“ und Psychosomatik
Auch bei Schlaflosigkeit ertappt man sich schnell dabei, dass man zu sich sagt „Ich will nicht wach sein.“ Dieses Nein zum eigenen Körper führt oft dazu, dass man wachbleibt. Das ist eine häufige Geschichte. Wenn ich Körpersymptome anschaue. Etwas passiert im Körper und der Verstand will das nicht und sagt „Nein“ dazu. Dann fängt er an, dagegen anzugehen. Und wenn wir jetzt das vegetative autonome Nervensystem nehmen und das macht viele Symptome, die im psychosomatischen Bereich sind, und ich gehe dagegen an, dann kämpfe ich. Und Kampf aktiviert das autonome Nervensystem. Das heißt, wenn ich dagegen ankämpfe, fahre ich die Aktivität des Systems hoch, welches das Symptom eigentlich vermittelt. Ein idiolektisches Gespräch kann dazu führen, dass ich eine andere Perspektive auf das bekomme, was da geschieht. Vielleicht denke ich immer noch „der Ton ist blöde“, aber wenigstens kann ich einen Film sehen mit dem Gerät. Oft reicht es, wenn die zusätzliche Spannung, die dadurch kommt, dass man sich über das Symptom ärgert, rauszunehmen. Und wenn der sekundäre Ärger darüber weniger ist, dann – oh Wunder – geht manchmal das Symptom ein bisschen zurück. Manchmal auch nicht, aber dann kann ich vielleicht besser damit umgehen, weil ich mich nicht die ganze Zeit über es ärgere. Das ist also ein universelles Muster bei solchen Sachen, die mit Körpersymptomen so arbeiten.
Dazu gibt es eine sehr schönes Buch von Peter Winkler: „Körpersymptome verstehen mit Evolutionärer Psychosomatik und Idiolektik – Seminare mit A. D. Jonas“, erschienen im Huttneschen Verlag 507. Er hat sich in seiner Arbeit sehr intensiv mit den Videos von Jonas auseinandergesetzt. Eine Schatzkammer von Original-Gesprächen von David A. Jonas.
Archaische Relikte
Sie heißen so, weil sie aus dem Altertum – archaisch – aus der Entwicklung nicht nur meines Lebens, sondern des Lebens der Menschheit kommen. Die Menschheit hat sich entwickelt unter archaischen Bedingungen. Man sagt ja auch so „durch die Steppe laufen“ oder „in der Höhle sitzen“. Das war ein gefährliches Leben. Wer Steven Pinker gelesen hat, der weiß, dass die Welt immer sicherer wird. Wenn man fernsehen guckt, sieht es anders aus, weil da immer die Gefahr gezeigt wird. Aber die Welt wird immer sicherer. Die Chance, an Mord oder Totschlag zu sterben wird immer geringer.
Das heißt, wir haben einen Körper entwickelt, der unter Gefahrensituationen gut überleben konnte. Unter Gefahrensituationen macht der Körper eine Aktivierung von allerlei Energien im Körper. Der stellt uns Energie über Zucker und elektrisch zur Verfügung, damit wir unsere Muskeln bewegen können, um zu kämpfen und zu fliehen. Das hat David A. Jonas auch beobachtet. Jahrelang hat er Primaten beobachtet und gesehen, wie sie sich unter bestimmten Bedingungen der Bedrohung verhalten. Die reden nicht mehr miteinander. Wenn die aber in Sicherheit sind, fangen die sich an zu lausen. Die unterhalten sich mit ihrem Körper, denn die haben gar nicht so viele Läuse. Sie tauschen sich aus mit Berührungen. Und das machen wir nicht mehr mit den Haaren auf dem Kopf, sondern mit den Innenohrhaaren und kitzeln uns mit Worten. Wir plaudern miteinander. Wir tauschen uns aus. Dieses soziale Verständigungssystem, das ist etwas, das wir in Sicherheit machen und das schafft auch Sicherheit.
Das, was wir mit Idiolektik für Bedingungen schaffen, ist Bedingung eines plauderhaften Gesprächs, wo wir über Dinge reden, wo sich die andere Person interessiert, wo sie sich auch auskennt, wo sie spielerisch damit umgehen kann. Und dieser Plauderton sorgt gleichzeitig dafür, dass im Körper ein Milieu von Sicherheit entsteht. Weil das ist das, in dem wir in früheren Zeiten miteinander geplaudert haben, am Feuer sitzend, einander anschauend und nicht mehr kämpfen müssen, nicht mehr lösen müssen, nicht mehr etwas angehen. Sondern einfach mal schauen, wie das Feuer so bruzzelt und der Fernseher läuft – alles nicht so „wild“. Sondern „Wir schauen es uns mal an“ und diese „gemeinsam am Feuer sitzen und miteinander schauen“-Haltung überträgt sich dann auch. Wenn ich als begleitende Person in der Haltung bin „lass uns mal ans Feuer sitzen und diese Angst, diesen Schmerz, diesen Tinnitus anschauen“, dann ist das alles nicht mehr so „O Gott, jetzt müssen wir was tun, das weg machen, dagegen ankämpfen“. Mein vegetatives Nervensystem in dieser Haltung überträgt sich auch auf die andere Person. Und wenn wir sie dann auch noch einladen, das auch so anzuschauen, in Kombination mit den paraverbalen Signalen einer melodiösen Stimme, dann breitet sich beim Betrachten eines Belastungsnetzwerkes etwas aus wie Sicherheit. Und das verbindet sich miteinander. Das führt häufig dazu, dass jemand hinterher sagt: „Ich habe jetzt auch noch keine Lösung, aber mir geht es besser“. Das Verrückte ist ja, dass wir nichts anderes machen als duale Aufmerksamkeit zu schaffen. Da ist eine Belastung, die besprochen wird, und es taucht auch Schönes auf – Fliegen, Perspektiven von oben, etc. – und das verbindet sich miteinander im System. Das ist das Spannende, dass wir das nicht machen müssen, sondern dass es einfach passiert. Was wir machen ist, wir plaudern über Dinge, über Ressourcen, mit Abstand, etc. und dann landen wir in Bereichen, wo sich etwas entfalten kann von angenehmen Erfahrungen die uns Ressourcen darstellen im Umgang mit dem Belastenden.
Übung „Organe personifizieren“
Ich lade Sie ein, einmal analog zum Demogespräch im vorhergehenden Blog (Teil 3) mit einem Körpersymptom zu arbeiten.
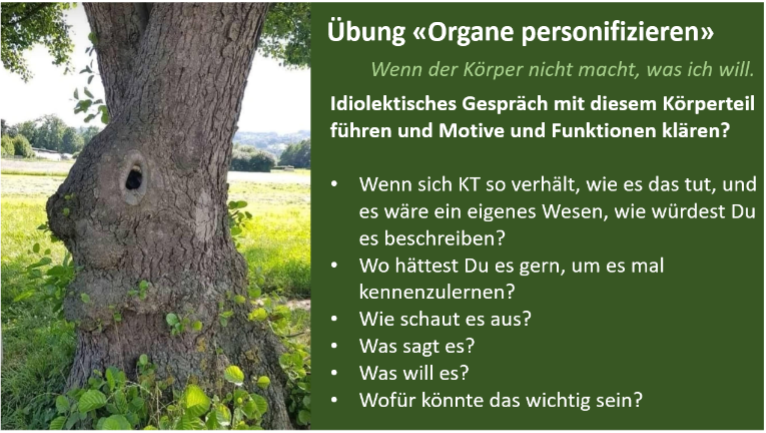
Man muss ein Körpersymptom oder Körperteil nicht immer am oder im Körper anschauen, man kann es auch nach draußen bringen, in einen äußeren Erfahrungsraum, wie den Fernseher im Beispiel oben. Der war nicht mehr im Kopf, sondern draußen und man konnte sich davorstellen. Dadurch erhält man Handlungsfähigkeit zu diesem Teil, den man nicht hat, wenn das Teil im eigenen Körper ist. Draußen ist man viel handlungsfähiger als drinnen.
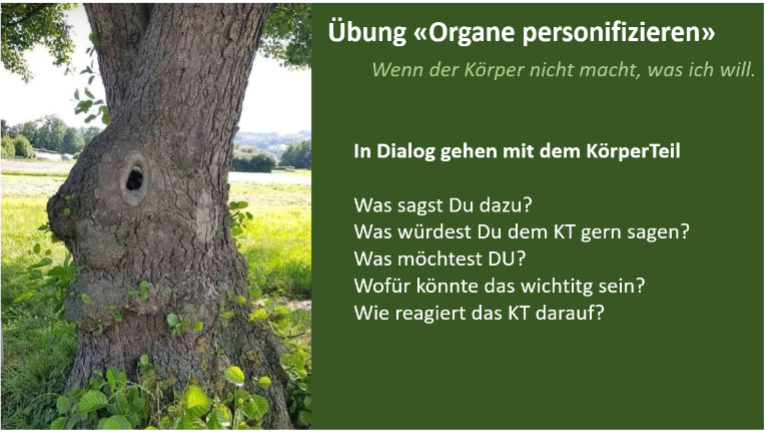
Das Schema in den Folien ist ein möglicher Vorschlag
Idiolektisches Gespräch mit diesem Körperteil führen und Motive und Funktionen klären.
• Wenn sich das Körperteil so verhält, wie es das tut, und es wäre ein eigenes Wesen, wie würdest du es beschreiben?
• Wo hättest du es gern, um es mal kennenzulernen?
• Wie schaut es aus?
• Was sagt es?
• Was will es?
• Wofür könnte es wichtig sein?
In Dialog gehen mit dem Körperteil
• Was sagst du dazu?
• Was würdest du dem Körperteil gerne sagen?
• Was möchtest du?
• Wofür könnte das wichtig sein?
• Wie reagiert das Körperteil darauf?
Körperprozesse begleiten
Wenn wir mit Metaphern arbeiten wird bei diesen Bilderprozesse häufig die rechte Gehirnhälfte und das Limbische System aktiviert: Diese sind für kreative Prozesse. Emotionsregulierung und Beziehungsregulation zuständig
Wenn wir dann in Körperprozesse kommen, haben wir gemerkt, dass wir in den Bereich archaischer Mechanismen kommen, die im Stammhirn verankert sind. Flucht-, Kampf- und Totstell-Reaktionen als Überlebens-Reflexe, die tatsächlich auch eher reflexhaft verschaltet sind, also gar nicht so viel Nachdenken erfordern, was mache ich, was will ich, sondern es passiert einfach. Mein Körper macht Sachen, die ich gar nicht will. Wenn ich nun aber mit dem Stammhirn sprechen will, dann kann ich das nicht. Um mit ihm in Kontakt zu kommen, brauche ich eine Zwischen-Station. Über Bilder komme ich viel eher an diese Prozesse heran, als wenn ich sie analysieren und verstehen will. Und ich brauche mehr Zeit für diese körpernahen Prozesse. Weil das Stammhirn wenig spricht. Und wenn, dann findet es kaum Worte für das, was da passiert.
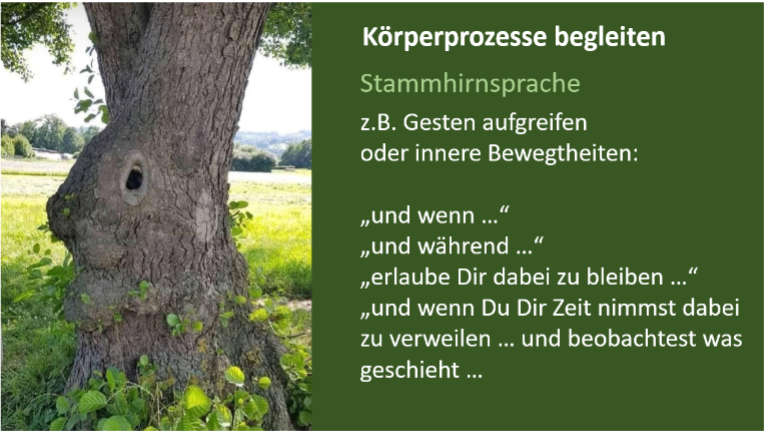
Das heißt, ich kann eher mit dem Stammhirn in Kontakt kommen, wenn ich Gesten aufgreife oder innere Bewegtheiten.
Und wenn ich Sprache anwende wie „Ahhh, und wenn da jetzt so ein ruhiges Gefühl im Kopf “ (in sehr langsamen Tempo, leise und ruhig gesprochen)
Lasst den anderen Personen Zeit bei angenehmen Zuständen, da auch zu verweilen mit „erlaube dir, dabei zu bleiben…“ Keine Eile beim Fragen.
Man muss auch gar nicht fragen, sondern kann einladen die Aufmerksamkeit auf einen Aspekt zu halten, indem man z.B. sagt „und wenn du dir Zeit nimmst, dabei zu verweilen … und beobachtest, was geschieht…“
Körperprozesse kann man eher vergleichen mit einem langsamen Fluss. Körperliche Rhythmen sind anders als die des Verstandes. Es braucht Geduld und Ruhe, um sie zu begleiten.
Der folgende Klient arbeitet als Psychologe mit Flüchtlingskindern in der Türkei. Das Gespräch findet im Rahmen einer Selbsterfahrungsgruppe mit Übersetzer statt.
Kl.: Ich bin sehr durcheinander.
Th.: Magst Du mir das Durcheinander beschreiben?
Kl.: Es ist schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen. Ich habe das Gefühl, wie beschossen zu sein, mich erwarten keine guten Sachen. Ich bin einsam. Und ich trage sehr viel Last, ich halte es nicht aus.
Th.: Was würdest Du bei den Kindern machen, mit denen Du arbeitest, wenn diese in einer solchen Situation wären?
Kl.: Bei Kindern, die eine zu große Last tragen, würde ich diese fragen, ob ich sie ihnen abnehmen darf. Falls das Kind es nicht möchte, dass die Last abgenommen wird, würde ich es begleiten.
Th.: Wo spürst Du die Last?
Kl.: Im Nacken? (Finger gehen dahin.)
Th.: Was machen Deine Finger?
Kl.: Sie spüren, das tut gut.
Th.: Wie ist es da?
Kl.: Kalt und weich.
Th.: Was wäre noch gut?
Kl.: Etwas Druck.
Th.: Magst Du das ausprobieren?
Kl.: (drückt mit den Fingern)
Th.: Was geschieht?
Kl.: Es breitet sich aus in die Beine. (Dort liegt seine andere Hand.)
Th.: Was macht die?
Kl.: Die versteckt sich.
Th.: Was möchte sie tun?
Kl.: Sie möchte mithelfen.
Th.: Kann sie das?
Kl.: Ja. (tut es)
Th.: Wie ist das?
Kl.: Tut gut, es wird noch besser.
Th.: Was brauchst Du jetzt?
Kl.: Jetzt brauche ich Zeit.
Dieser Gesprächsprozess enthält viele Angebote in der Körpersprache des Klienten. Beim Aufgreifen durch den Therapeuten ist bemerkenswert, wie langsam das Tempo dieses Gesprächs fließt. Allgemein benötigt es bei Prozessen, die auf einer körperlichen Ebene mitgespürt werden und durch die der Klient sich bewegt und fühlt, viel Zeit, damit die Aufmerksamkeit wirklich auf der Körperebene folgen kann. Spüren braucht Zeit, „Bildern“ auch, während kognitive Prozesse häufig schneller ablaufen, damit aber auch eher an der Oberfläche bleiben, was manchmal durchaus einen (schützenden) guten Grund haben kann.






