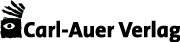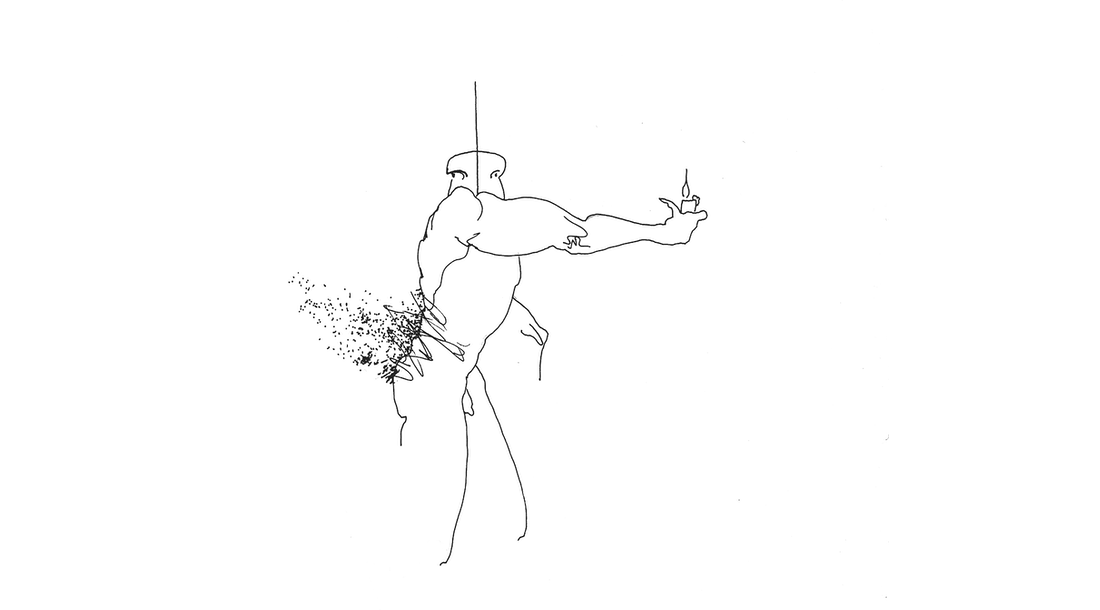Trump wirkt wie der Hauptprotagonist einer griechischen Tragödie
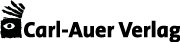
Trumps Rede vom 5.11. im Weißen Haus zeigte einen Präsidenten, wie ich ihn, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, niemals gesehen habe. Energielos, kraftlos und ohne die für ihn typische gestische Akrobatik las er die Litanei von (unhaltbaren) Anschuldigen von seinem Manuskript ab.
Mit monotoner Stimme redend wirkte er langweilig, gelangweilt und sichtlich genervt. Wenn er aufblickte, schaute er nur für einen Moment, beinah stets in eine Richtung, um dann sich dann erneut seiner Litanei hinzugeben.
Es scheint als könnte er nicht ohne dieses Manuskript. Nicht mehr. Er, der für seinen furiosen Habitus und seine krassen, stets frei vorgetragenen Reden weltweit bekannt und gefürchtet war.
Trumps Vortrag war keine Rede mehr. Keine Selbst-Präsentation mehr. Keine Zurschaustellung seiner Selbst, um gerade hierdurch (zumindest seine Fans) zu überzeugen.
Trump konnte überzeugen. Trump konnte polarisieren. Trump konnte gewinnen. Jetzt aber, steht da ein verzweifelter Redner vor der Weltöffentlichkeit. Ein Mann, der sich nur noch für den Bruchteil einer Sekunde spontan innerlich, für den aufmerksamen Beobachter auch äußerlich sichtbar, aufzurichten schien. Um dann wieder in sich zusammenzusinken. Und um Sicherheit und Schutz im vorliegenden Manuskript zu suchen.
Er konnte offensichtlich nicht mehr alleine. Er wirkte dabei wie ein geprügelter Hund, der schließlich von der Bühne abtretend wie ein geschlagener Krieger das Feld verließ.
Trump suchte, so seine Biographen, stets und lebenslang die Liebe seines Vaters. Des Vaters, der ihn von Geburt an auf Sieg eichen wollte. Ihm, dem Sohn, aber die nötige Liebe versagt hatte.
In diesem Moment wirkte Trump auf mich wie die Figur aus einer griechischen Tragödie, die so, in dieser Woche erlebt, von der Bühne abtritt und die Zuschauer im Theaterraum allein zurück lässt.
Mehr zu dieser Einschätzung im Interview, das focus TV mit mir drei Stunden vor der Bekanntgabe von Bidens Sieg gemacht hatte.