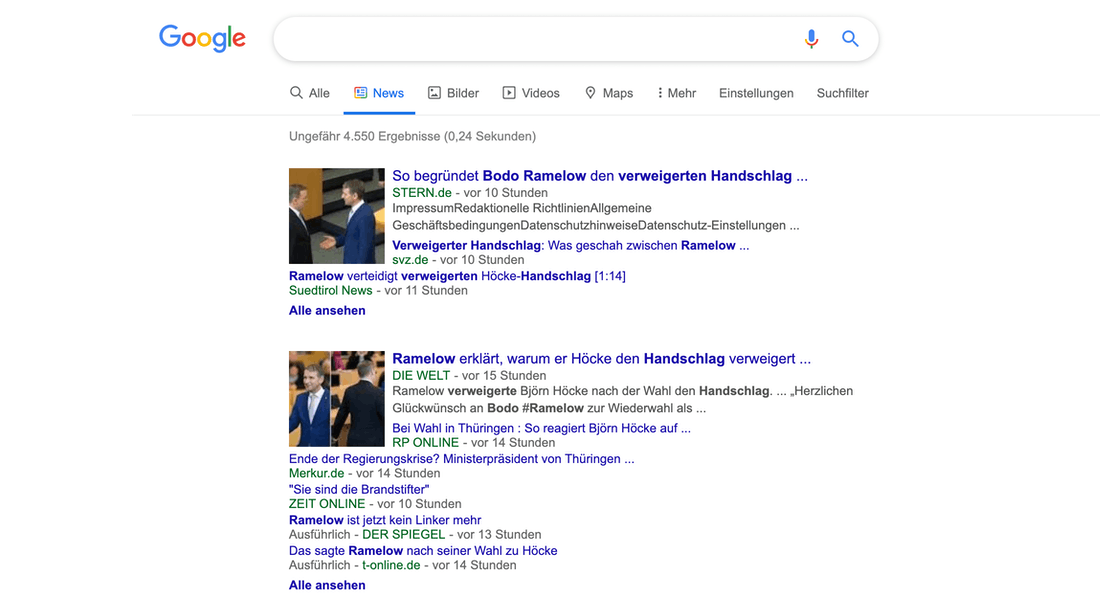Der Osten: eine ostdeutsche Erfindung
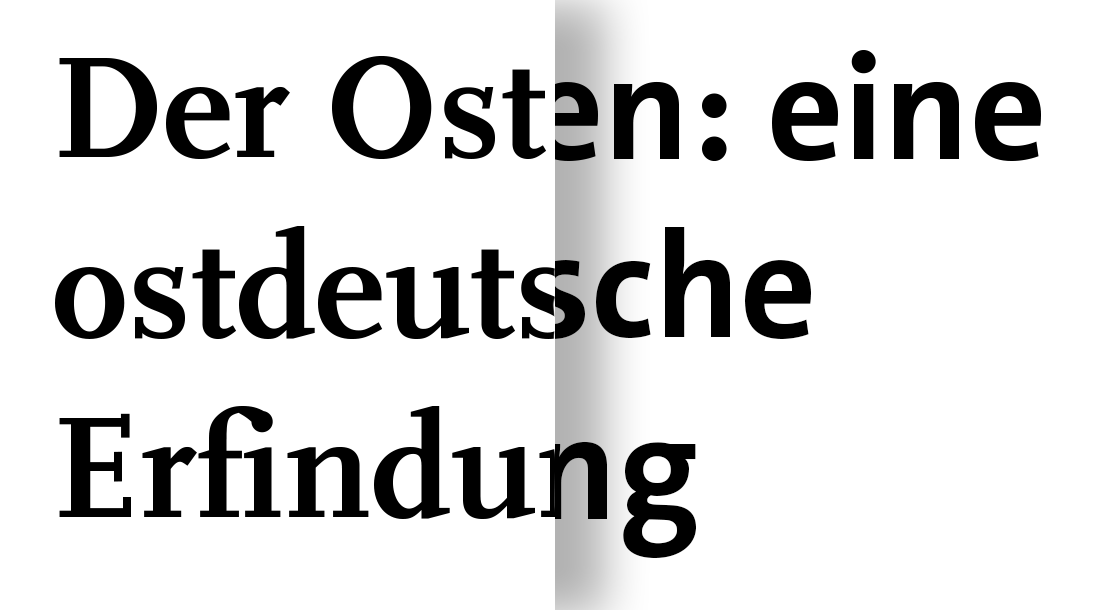
Zur Zeit werden die Bestsellerlisten von Dirk Oschmanns Buch „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“ angeführt. Es trifft offenbar einen Nerv – vor allem in Ostdeutschland, wo etwa 75% der Verkäufe stattfinden (24,9% des Restes würde, wie der Autor bei Markus Lanz sarkastisch bemerkte, wahrscheinlich von im Westen lebenden, aber aus den ostdeutschen Bundesländern stammenden Personen gekauft).
Um es vorweg zu nehmen: Es ist ein lesenswertes Buch, das auch im Westen gelesen werden sollte. Und ich kann, soweit es die dargestellten Fakten angeht, nichts an diesem Buch kritisieren (soweit ich das alles beurteilen kann). Auch der oft wütende, manchmal gekränkte oder auch ein wenig beleidigte Ton des Textes scheint mir passend und angemessen. Er analysiert – als Literaturwissenschaftler – den aktuellen Diskurs, zeigt detailliert und genau Kommunikationsmuster auf, analysiert den Sprachgebrauch, die Implikationen der gebrauchten Begrifflichkeiten, die Sprachspiele. All dies geschieht mit professioneller Kompetenz und ist in seiner Stichhaltigkeit nicht in Zweifel zu ziehen. Was aber fehlt, und hier scheint mir die Argumentation unzureichend zu sein, ist ein systemtheoretischer Blick. Auch wenn aus kommunikationstheoretischer Sicht die Beschreibungen des Autors nicht zu bemängeln sind, hat er offenbar – trotz der häufigen Verwendung des Begriffs System – kein Verständnis für die Funktionslogik sozialer Systeme. Hier scheint es mir nützlich, die Perspektive ein wenig zu erweitern…
Als an Systemtheorie interessierter Praktiker, der seit 50 Jahren seinen Lebensunterhalt mit fremder Leute Konflikte verdient, hat sich für mich die Differenzierung von Wirklichkeitskonstruktionen in die Beschreibung von Phänomenen, ihre Erklärung (d.h. die Konstruktion von Kausalität) und ihre Bewertung (sei sie sachbezogen oder emotional) bewährt. Ich kann und will daher im Folgenden nicht die Beschreibung des aktuellen Deutsch-deutschen Verhältnisses, die der Autor liefert, in Frage stellen, auch nicht seine Bewertung – schon gar nicht die affektive Färbung –, aber ihre Erklärung.
Um meine Position und Perspektive als Beobachter zu deklarieren, will ich – wie Dirk Oschmann – zunächst meinen persönlichen Zugang zum Thema offenlegen. Ich bin im Nachkriegswestdeutschland geboren, ein paar Wochen nach Einführung der D-Mark und ein paar Monate vor Gründung der Bundesrepublik. Meine Familie war aus Schlesien geflüchtet, hatte „alles verloren“. Niemand hatte die Illusion, die Teilung Deutschlands sei rückgängig zu machen. Wir hatten keine Verwandten in der „Ostzone“. Aber die besten Freunde meiner Eltern, Nachbarn, hatten viele Verwandte im Erzgebirge. Sie stammten aus Aue, und so schickten sie regelmäßig „Päckchen nach drüben“. Kaffee, Schokolade, alles, was gut und mit sinnlichem Genuss verbunden ist – so schien es mir. Weihnachten gab es dann im Gegenzug die unvermeidlichen, klein Holzhäuschen mit einem Propeller auf dem Dach, der durch die heiße Luft brennender Kerzen angetrieben wurde.
Mein Bild der „Zone“ war: grau, freudlos, uninteressant, eingesperrt, lustlos, ohne Schokoladenseiten. Als 18Jähriger machte ich mit meiner Abiturklasse eine Reise nach West-Berlin und besuchte mit drei oder vier Klassenkameraden Ost-Berlin. Etwas gruselig die Kontrollen am Bahnhof Friedrichstrasse, das Bier und Essen billig, der Blick auf das hinter Absperrungen in großem Abstand sichtbare Brandenburger Tor irgendwie trostlos. Ich kaufte für wenig Geld in einem Laden, der so grau wirkte wie die ganze Stadt, drei Bände mit Lenins Werken (habe ich immer noch).
Meinen zweiten Kontakt mit dem nunmehr DDR genannten, fremden Land hatte ich Mitte der 70er Jahre, als ich während eines Bulgarienurlaubs zwei Musiker aus Dresden kennenlernte. Er spielte in der Dresdner Staatskapelle, sie im Gewandhausorchester. Sie luden mich und meine damalige Freundin ein. Wir besuchten Sie, wohnten bei ihnen und ließen uns in die Wunder und Geheimnisse Dresdens einführen. Beide waren nicht nur älter als wir, sondern auch gebildeter, kultivierter, wohlhabender und weltläufiger als wir. Sie hatten mit ihren Orchestern die Welt bereist (nur nie gemeinsam), hatten ein Auto, wohnten in einer großen Wohnung mit Blick in die Prager Straße. Sie führten uns ins Theater, in Konzerte und Museen, zeigten uns Bilder von DDR-Künstlern, von denen wir nie etwas gehört hatten (wie Wolfgang Mattheuer, Willi Sitte, Bernhard Heisig u.a.). Und sie führten uns in den „Club der Intelligenz“, in einer pompösen Villa auf den Hügeln Dresdens, wo wir – an einem normalen Arbeitstag – von Kellnern im Frack bedient wurden. Doch Dresden, das wurde von unseren Gastgebern immer wieder betont, war auch das „Tal der Ahnungslosen“, weil dort kein Westfernsehen zu empfangen war. All das war interessant, aber auch ein wenig kurios. Der Kontakt zu diesen wunderbaren Dresdnern wurde von beiden Seiten leider nicht sehr lange weiter gepflegt, wahrscheinlich auch, weil wir keine Gegenleistung bieten konnten („Päckchen nach drüben“ brauchten unsere Gastgeber nicht) und alle Beteiligten genug mit der Bewältigung ihres Alltags zu tun hatten. Mein Interesse an der DDR war durch diesen sehr Besuch aber nicht dauerhaft geweckt. Und auch wenn ich nicht wirklich weiß, ob mein Beispiel verallgemeinert werden kann, so scheint mir die Hypothese doch ganz plausibel, dass die Neugier auf die DDR bei meinen Altersgenossen – und erst recht bei Jüngeren Westdeutschen – sehr begrenzt war. Und ich muss auch gestehen, dass für mich (wahrscheinlich uns) die Vereinigung beider deutscher Staaten kein Anliegen war. Kurz gesagt: Die DDR war mir/uns egal, denn dort gab es nichts, was im Vergleich zum Rest der Welt, die uns offen stand, attraktiv erschien. Dennoch kamen auch mir die Tränen, als die Mauer fiel (was aber nicht viel bedeutet, denn ich heule auch im Kino, wenn lang getrennte Liebende sich wiederfinden). Doch Liebe ist die falsche Metapher, um das deutsch-deutsche Verhältnis zu beschreiben. Sie war zumindest nicht gegenseitig. Die Bewohner der DDR haben auf den Westen geschaut, aber der Westen hat nicht zurückgeschaut. Wie auch Dirk Oschmann schreibt: Man sah die Tagesschau im Westfernsehen, hörte westliche Musik, besorgte sich Platten aus dem Westen, war dankbar für jede Westmark, mit der man im Intershop Westwaren kaufen konnte. Niemand in der alten BRD sah sich die Aktuelle Kamera an, niemand hörte Frank Schöbel oder Karat. Selbst ihre Hits wurden im Westen erst bekannt, als sie von Peter Maffay gesungen wurden.
Man orientierte sich am Westen. Und damit verbunden war eine Selbstabwertung – nicht des Einzelnen, aber der DDR. Und da die individuelle Identität durch das Potpourri der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen sozialen Systemen definiert wird, war damit auch implizit und unbewusst die Wahrscheinlichkeit einer individuellen Selbstabwertung verbunden. Eine Abwertung, die durch den Westen ihre Bestätigung fand: „Warum heißt es, unsere Brüder und Schwestern in Ostdeutschland?“ – „Brüder und Schwestern kann man sich nicht aussuchen!“ Und nach dem Mauerfall hieß es dann: „Warum lächeln die Chinesen?“ – „Die haben ihre Mauer noch!“
Die „Päckchen nach drüben“ und das Westfernsehen usw. mögen als Beispiele dafür reichen, dass zwischen Ost und West (womit jetzt nicht einzelne Menschen, sondern das Kollektiv der Bevölkerung gemeint sein soll) seit ewigen Zeiten eine asymmetrischen Beziehung bestand, der Bewertung nach: eine Oben-unten-Beziehung – und zwar nicht nur aus der West-Perspektive, sondern auch aus der Ost-Perspektive. Um das unmissverständlich zu formulieren: Es war der Osten, der sich durch die Beobachtung und den Vergleich mit dem Westen zum Osten machte. Klar, auch der Westen bestätigte ihn, wenn er ihn denn überhaupt wahrnahm. So, wie man sich generell als Deutscher meist erst erkennt und definiert, wenn man in ein fremdes Land fährt. (Ich persönlich habe mich zum ersten Mal in meiner „Deutschheit“ – so peinlich mir das war – erkannt, als ich mehrere Monate durch Indien fuhr.)
Um die deutsch-deutsche Beziehung in ein (natürlich wie stets irgendwie unangemessenes) Bild zu bringen: Die Dynamik war in ihrer Anfangsphase der einer Paarbeziehung ähnlich, in der ein Partner weit mehr am anderen interessiert ist als umgekehrt. Es ist tragisch, wenn eine(r) liebt, aber diese Liebe nicht erwidert wird. Selbst wenn es dann zum „Bund fürs Leben“ kommt, bleibt diese Asymmetrie meist bestehen. Eine aus caritativen Erwägungen geschlossene oder aus moralischen Gründen erzwungene Partnerschaft hat in Zeiten, in denen Liebensheiraten die stillschweigende Erwartung sind, meist etwas Schräges. Ihr fehlt die Gegenseitigkeit, die Reziprozität. Und da die Entwicklung solcher Partnerschaften in ihrer Geschichte pfadabhängig sind, wird diese Asymmetrie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Dauer gestellt, d.h. immer wieder in der Interaktion re-inszeniert. Wie sich das dann im Alltag darstellt und dass es als demütigend von den Betroffenen erlebt wird, hat Oschmann deutlich dargestellt.
Wahrscheinlich ist der Begriff Wiedervereinigung schon irreführend, denn so wurden die Ereignisse ja nur von den Leuten verstanden, die vor dem Krieg ein ungeteiltes Deutschland erlebt hatten (z.B. die Generation Helmut Kohls oder Willy Brandts); für alle nach dem Krieg Geborenen war es die Vereinigung zweier bis dahin als getrennt erlebter Staaten. Wie immer man das Geschehen nur nennen mag, was nicht bedacht wurde (obwohl Kritiker das Scheitern schon damals prophezeiten), ist, dass die DDR wie die BRD eine eigene Geschichte hatten. Es waren soziale Systeme, die ihre Grenzen – und damit ist nicht die Mauer oder der Eiserne Vorhang gemeint, sondern die kommunikative Herstellung von Innen-außen-Unterscheidungen – autonom über Jahrzehnte hergestellt hatten. Sie hatten ihre je eigenen kulturellen Muster entwickelt. Und es war vorherzusehen, dass die Integration beider nicht ohne Konflikte abgehen würde. Wenn – wie von manchen vorgeschlagen (und von mir immer favorisiert) ein Staatenbund zwischen beiden deutschen Staaten begründet worden wäre, dann hätte man auf Augenhöhe verhandeln können, welche Aspekte der DDR-Institutionen von der BRD übernommen werden könnten, welche umgekehrt von der DDR, wie eine gemeinsame Verfassung aussehen könnte usw. Jeder Bürger jedes der beiden Staaten hätte sich den zu seinem Wertsystem passenden Staat als Wohnort und Lebenswelt wählen können, die getrennte Entwicklung hätte weiter gehen können, aber unter der veränderten Bedingung, dass die Bürger sich frei von West nach Ost und von Ost nach West bewegen konnten. Es hätte einen Wettbewerb der Systeme geben können, in dem beide eine Chance gehabt hätten.
Aber was soll‘s: Man bekommt die Zahnpasta nicht mehr in die Tube. Der Beitritt zur Bundesrepublik war wohl der schnellste Weg, und vielleicht war das ja die einzige Möglichkeit die Gunst des Augenblicks zu nutzen. Denn die Freunde Deutschlands im Westen, an erster Stelle Margaret Thatcher, liebten Deutschland so sehr, dass sie am liebsten weiter zwei davon gehabt hätten.
In der Logik eines Beitritts, ist die Asymmetrie impliziert, d.h. die Frage, wer sich wem anpassen muss, stellt sich nicht mal mehr, denn es ist klar, dass der Hinzukommende sich einfügen muss. Aber das wäre wahrscheinlich kein so großes Problem (trotz der kulturellen Unterschiede, angesichts der Idealisierung des Westens) gewesen, wenn nicht die DDR-Wirtschaft nunmehr in ein marktfundamentalistisches System geworfen worden wäre, in dem sie zum Absaufen verdammt war. Um auch hier einen Vergleich zu verwenden: Es war als ob man den ganz talentierten Boxer einer Jugend-Mannschaft in den Ring zum Kampf mit dem Schwergewichtsweltmeister schickt. Und das nicht nur zum Spaß, sondern in einen Kampf auf Leben und Tod. Obwohl die DDR-Wirtschaft in der Welt zu den leistungsfähigsten vor der Vereinigung (nicht Wieder-…) gehörte, wurde sie nun de facto auf Null gesetzt. Was das für die Bevölkerung bedeutete hat Dirk Oschmann hinreichend dargestellt, so dass ich mir das hier ersparen kann. Der Wunsch, die D-Mark zu erhalten, wurde bitter bestraft.
Nun aber zum Kern dessen, was mir an Oschmanns Darstellung zu fehlen bzw. falsch zu sein scheint. Denn seine Erklärungen sind implizit personenorientiert, auch wenn keine konkreten Schuldigen für die Misere benannt werden. Es mag an seiner Profession als Literaturwissenschaftler liegen, dass er letztlich immer die Folie von Dramen zu seiner Deutung der Situation verwendet. Implizit geht es um Leute, die von … gezwungen wurden, dies oder jenes zu tun, oder davon abgehalten wurden, dies oder jenes weiter tun zu können. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Dieser Zwang dürfte bestanden haben und immer noch bestehen, aber die Verantwortung ist nicht wirklich irgendwelchen konkreten Akteuren zuzuschreiben, sondern der Logik des Systems. Wir leben in der funktionell differenzierten Gesellschaft, in der gesellschaftliche Subsysteme wie die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Kunst, die Politik nach ihrer jeweils unterschiedlichen Logik funktionieren. Das heißt, die Entscheidungen der beteiligten Akteure folgen jeweils unterschiedlichen Rationalitäten. Der Beitritt der DDR zur BRD hatte katastrophale Folgen, weil er vor allem ein Beitritt zur westlichen (mehr oder weniger) freien Marktwirtschaft war. Verschärfend kam hinzu, dass zu der Zeit der von Reagan und Thatcher promotete und auch in Deutschland immer mehr Anhänger findende Marktfundamentalismus (eine idiotische Ideologie, die sich weder theoretisch noch empirisch wissenschaftlich begründen lässt) die Politik bestimmte. Der Markt würde es schon regeln, was krimineller Quatsch war, denn unregulierte Märkte verschärfen generell soziale Unterschiede. Sie funktionieren nach dem biblischen Matthäus-Prinzip („Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen!“). Wer reich ist, wird immer reicher, wer arm ist, wird arm bleiben, wenn er nicht gar immer ärmer wird. Und da die Leute aus dem Westen relativ reich waren, konnten sie den Osten leer kaufen… usw. Die Politik hätte die Chance gehabt, kollektiv bindende Entscheidungen zu treffen, die der Ostwirtschaft einen langsamen Übergang ermöglicht hätte. Das politische Versagen, dessen Folgen die Ostdeutschen, ja, die gesamte Bundesrepublik, bis heute auszubaden haben, bestand darin, die wirtschaftliche Logik hierarchisch allen anderen Wertsystemen überzuordnen. Daher tauchte nichts, was an der DDR-Geschichte erhaltenswert war, in den kurzfristigen ökonomischen Kalkulationen und Entscheidungen auf. Und die krude Marktlogik bestimmte den Pfad der weiteren Entwicklung. Das ist nicht ganz ohne Ironie, denn schließlich war der schnelle Beitritt zur BRD auch (wenn nicht vor allem) durch den Wunsch, endlich die DM zu erhalten, motiviert.
Gibt es Beispiele für diese Art der Vereinigung sozialer Systeme? Ich dachte zunächst an die verschiedenen Formen des Mergers zwischen Unternehmen (von denen die meisten – nebenbei bemerkt – ja auch scheitern bzw. nicht den erhofften wirtschaftlichen Erfolg haben). Mir kam zunächst die „feindliche Übernahme“ in den Sinn, denn ein „Merger of Equals“ war es ja auf keinen Fall. Schließlich lieferte die Ungleichheit ja die Motivation dafür, dass überhaupt jemand diese Vereinigung anstrebte. Aber bei einer feindlichen Übernahme versucht der Übernehmer die Kontrolle über den Übernahmekandidaten (d.h. das jeweilige soziale System/Unternehmen) zu gewinnen. Hier war es jedoch umgekehrt: Das übernommene System hatte darum angesucht, endlich übernommen zu werden. Statt feindlicher Übernahme müsste wohl von (um mir nun möglichst viele Feinde zu machen) von „caritativer Übernahme“ gesprochen werden, von Vormundschaft, Betreuung durch die Fürsorge, Pflegschaft oder etwas Ähnlichem (aber das sind natürlich schon wieder personenorientierte Metaphern, deren Implikationen von der Übernahme soziale Spielregeln und deren Folgen ablenken können).
In der Praxis erfolgte die Vereinigung nämlich nach dem Modell der Kolonialisierung (die ja meist noch mit einer Mission verbunden war, der Verbreitung einer Religion, eines Glaubenssystems – hier des Marktfundamentalismus). Ein Bild, das Oschmann auch verwendet. Ganz ähnlich wie im britischen Kolonialreich die Loser, die zuhause nicht reüssierten in die Kolonien gingen, um dort die Verwaltung, das Offizierschor und die Justiz usw. mit Personal zu versorgen, zogen nun die im Westen Zukurzgekommenen in den Osten und besetzten die dort neu geschaffenen oder frei geschaufelten Posten. Denn nun galten die Spielregeln des Westens, die konnte von der indigenen Bevölkerung nicht sofort ausgefüllt werden… Sie wurde zum Opfer der Verhältnisse. Und die Verhältnisse waren Folge des Beitritts zu einem fremden System, das großherzig bereit war, die bucklige Verwandtschaft aufzunehmen und mitzuschleppen. Aber es war eben nicht nur eine Menge Einzelner, sondern es wurde ein soziales System mit seinen eigenen Spielregeln übernommen. Und die wurden nur dort außer Kraft gesetzt, wo es formal möglich war. Die Regeln des Wirtschaftens wurden von einem Tag zu anderen geändert, aber Kulturen kann man nicht per Beschluss verändern. Sie und ihre Regeln überleben politische Entscheidungen und ändern sich nur sehr langsam und unter Widerstand.
Was gleich blieb, ja, sich sogar erheblich verschlechterte, war die wirtschaftliche Situation. Der Fluch der D-Mark ereilte große Teile der Bevölkerung. Und dafür wurde der Staat verantwortlich gemacht. So gab es einen konstanten Faktor im Leben der Ex-DDR-Bürger: die Ablehnung des Staates bzw. seiner Institutionen. In der DDR war man gegenüber dem Staat misstrauisch, und nach dem Schock der Vereinigung wurde auch der BRD-Staat ent-idealisiert, und die alte Erkenntnis, dass man dem Staat nicht trauen kann, wurde hervorgekramt und erneut bestätigt. Ein gemeinsamer Feind schafft immer Solidarität. „Wir sind das Volk!“, „Merkel muss weg!“ Und dieser Feind ist es, dessen Opfer man ist.
Das Opfer-Narrativ scheint durch die Argumentation Oschmanns durch, auch wenn er das nicht beabsichtigt haben mag. Dass er – wie viele in den östlichen Bundesländern – wütend ist, ist verständlich. Das Problem ist, dass man fast immer, wenn man sich bewusst oder unbewusst als Opfer definiert, die Suche nach einem Täter beginnt. Auch wenn viele Leute aus dem Westen Nutznießer der Vereinigung waren (Stichwort: Immobilienkäufer), so sind es keine personalen Täter, die für die miese Situation verantwortlich zu machen sind. Es ist die Funktionslogik des Wirtschaftssystems. Das sieht Oschmann zwar auch, misst ihm aber nicht das m.E. angemessene Gewicht bei. Das zeigt sich beispielhaft an seiner Interpretation der Karrieren an Hochschulen. Dass dort Seilschaften und Netzwerke bestimmen, wer auf Lehrstühle gelangt, ist im Westen nicht anders als im Osten. Auch dort haben bestimmte Leute, die für bestimmte Schulen stehen oder nicht zu den richtigen Netzwerken gehören, keine Chance. Ich habe etliche Freunde und Kollegen oder auch Coaching-Klienten bei ihren mühevollen Wegen durch demütigende Bewerbungsverfahren und Spießrutenläufe bis auf Lehrstühle begleiten können, so dass ich weiß, wie das abläuft (obwohl ich selbst mich dem weitgehend entziehen konnte). Das Problem jedes Opfer-Narrativs ist, dass derjenige, der sich als Opfer definiert, implizit (sich oder anderen) sagt, er sei hilf- und machtlos. In Beratungsprozessen rate ich meinen Klienten, die sich (oft ganz zu Recht) als Opfer definieren, sich als „Täter“ zu definieren. Denn wer sich als Opfer definiert, kreiert auf der anderen Seite der Unterscheidung den Täter. Er ist es dann, der etwas „tun“ und damit verändern kann. Daher ist – ungeachtet der Fakten – strategisch nützlich, sich stets als Täter zu definieren. Das führt dann zur Reflexion: „Wie habe ich es geschafft, den Wagen gegen die Wand zu fahren?“ Diese Frage mag zwar in Anbetracht der Fakten falsch, ihr Sinn ist auch nicht die Suche nach der Wahrheit oder Schuldigen, sondern wieder handlungsfähig zu werden. Wenn eine soziale Situation, eine gesellschaftliche Struktur, ein Kommunikationsmuster usw. als negativ bewertet wird, so bleibt dies nicht einfach statisch so, wie es ist, sondern es wir aktiv aufrechterhalten. Nichts bleibt so, wie es ist, wenn nicht irgendwer oder -was es aufrechterhält. Wer sich als Täter definiert, kann etwas ändern. Opfer hingegen warten darauf, dass andere etwas ändern – und daher warten sie, bis sie schwarz (oder braun) werden.
Was also kann der Osten (als Kollektivsingular) tun? Als erstes sollte er nicht weiter versuchen, von einem Partner, der nicht wirklich an ihm interessiert ist, geliebt zu werden. Symmetrie und Augenhöhe kann man nicht einklagen. Nicht-wahrgenommen-Werden ist die stärkste und härteste Art der kommunikativen Abwertung. Hier hilft keine Klage – weder Jammern noch vor Gericht. Was man aber tun kann – und das weiß jeder Terrorist –, man kann sich aggressiv zeigen und sein Gegenüber verletzen. Wenn dein Nachbar dich nicht zur Kenntnis nimmt, tritt ihm vor’s Schienbein. Spätestens dann nimmt er deine Existenz zur Kenntnis. Es ist zwar nicht schön, aber auf diese Weise wird eine – wenn auch nicht freundliche oder freundschaftliche – Beziehung hergestellt. Die totale kommunikative Entwertung ist aber beendet. Ab nun kann über die Art der Beziehung verhandelt werden. Beziehungen lassen sich nicht dauerhaft einseitig definieren. Sie bedürfen der Übereinstimmung, zumindest der Akzeptanz solch einer Definition durch beide Seiten. Dass die AfD eine hohe Zustimmung in den ostdeutschen Bundesländern gewinnt, kann auch als solch ein Schienbeintritt interpretiert werden (der inzwischen ja auch im Westen populärer zu werden scheint). Dass man sich bei aggressiven Akten auch gelegentlich selbst Schäden zuzieht und sich beim Schienbeintritt das Bein bricht, spielt dann oft keine Rolle mehr (es ist bekannt, dass auto-aggressives Handeln oft als Widerstand gegen bestehende Machtverhältnisse zu werten ist – Stichwort: öffentliche Selbstverbrennungen). Und das scheint mir bei den Wahlerfolgen der AfD auch zu gelten. Ihre Beliebtheit im Osten ist von der Sache her widersinnig. Sie wird dort nicht nur von Möchtegernführern geleitetet, die im Westen gescheitert sind oder keine Chance auf Erfolg gehabt hätten (Stichwort: Loser in die Kolonien), sondern ihr Programm verspricht der Bevölkerung genau das, was den Osten in die Misere geführt hat.
Die Auflösung der Ost-West-Asymmetrie kann nicht vom Westen gewährt werden, sondern kann nur durch die praktizierte Unabhängigkeit durch einen selbstbewussten Osten selbst erreicht werden. Er muss sich neu erfinden, und zwar als soziale Einheit, die sich nicht am Westen orientiert, die nicht auf dessen Anerkennung wartet, sondern selbstbewusst ihren eigenen Weg sucht und geht – soweit das unter den aktuellen Bedingungen der Bundesrepublik möglich ist. Nur so kann langfristig eine deutsch-deutsche Beziehung auf Augenhöhe erreicht werden. Pegida, Querdenkerszene, Verschwörungstheoretiker, Montagsdemos können alle in diesem Sinne gedeutet werden. Das Problem ist allerdings, dass auf diese Weise paradoxe Wirkungen erzielt werden. Wer bislang noch keine Vorurteile über den Osten hatte, bildet sie nun als vermeintliche Urteile.
Wahrscheinlich wird erst für die Generationen derer, die in der zweiten Hälfte der 80er Jahre oder später geboren wurden und in einem nicht geteilten Deutschland aufwuchsen, die Ost-West-Unterscheidung in ihren inneren Landkarten keine Relevanz mehr besitzen...