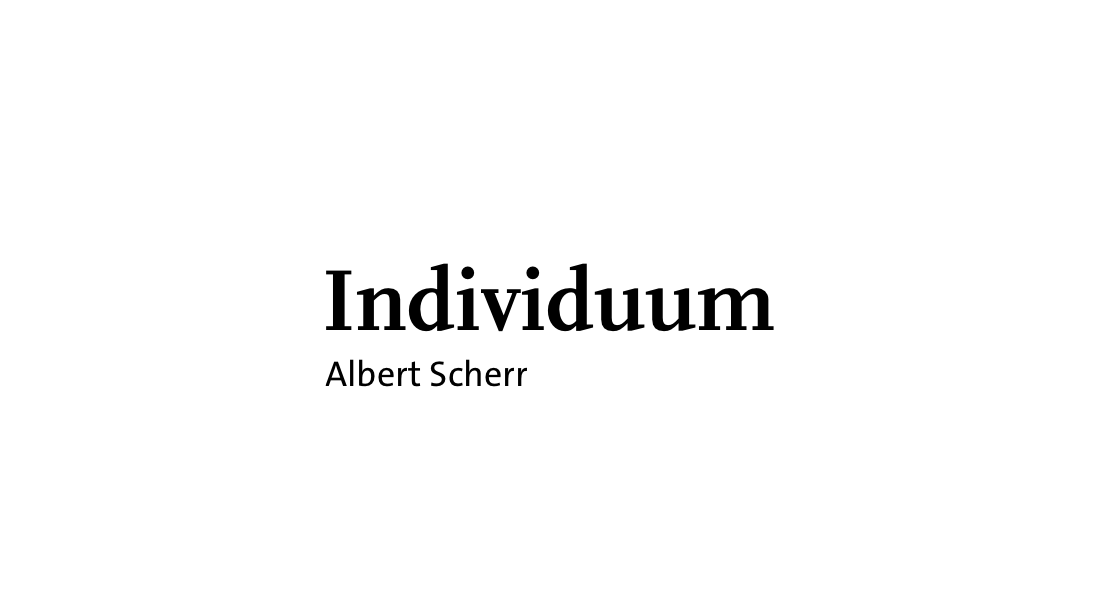Zeit

engl. time, franz. temps m; bildet in der Systemtheorie neben der Sachdimension und der Sozialdimension die dritte Dimension von Sinn. Zeit wird in dieser Perspektive nicht als ontologische Gegebenheit aufgefasst, sondern an Systemoperationen gebunden. Insofern steht der systemtheoretische Zeitbegriff nicht in Konkurrenz zum physikalischen Zeitbegriff, vielmehr wird auch dieser als Resultat einer systematischen Beobachtungspraxis (z. B. von Messhandlungen) gedeutet. Eine systemische Theorie der Zeit modelliert somit das Problem, dass jede Zeitsemantik gleichzeitig Zeit konstituiert und in Anspruch nimmt. Sie schließt dabei an theoretische Vorarbeiten Edmund Husserls und Alfred North Whiteheads an (vgl. Nassehi 2000). Im Zuge der Rückbindung von Zeit an Systemoperationen unterscheidet die Systemtheorie zwei Differenzen, erstens die Differenz von Element und Relation und zweitens die Differenz von Operation und Beobachtung. Aus der theoretischen Bearbeitung dieser beiden Differenzen gewinnt die Systemtheorie die zeittheoretisch zentrale Unterscheidung von Systemzeit und Beobachtungszeit. Systemzeit als Modus basaler Selbstreferenz: Autopoietische (Autopoiesis) Systeme bestehen, so heißt es bisweilen verkürzt, aus Elementen, die sie selbst erzeugen. Dabei ist zu bedenken, dass Elemente nach Luhmann nicht als »unveränderliche[...] Baustein[e] des Seienden oder als inavariante [...] Bestandteil[e] dynamischer Systeme zu verstehen« sind (vgl. Luhmann 1984, S. 42 f.). Elemente bilden keinen Bestand, sie haben keine (beobachtungsfreien) Eigenschaften, sie sind nichts jenseits ihres von anderen Elementen Unterschieden-worden-Seins, für die dasselbe gilt. Man mag sich die elementaren Ereignisse eines Systems, bei aller Vorsicht im Umgang mit Anschaulichkeiten, nicht als vorrätige kleine Bauklötzchen vorstellen, sondern eher als aufblitzende Lichter, die, obwohl (bzw. gerade weil) sie laufend verglühen, doch von einem Beobachter zu Spuren einer Leuchtreklame zusammenbeobachtet werden. Elemente sind, in dieser Perspektive, Unterscheidungsereignisse, die in allen Relationierungen »eine Verweisung auf diese Selbstkonstitution mitlaufen« (ebd., S. 59) lassen. Die Selbstkonstitution der Systemelemente durch Relationierung von Ereignissen bezeichnet Luhmann als »basale Selbstreferenz«. Unter zeittheoretischem Aspekt ist dabei wichtig, dass Systeme als Verkettung (Relationierung) von elementaren Ereignissen stets in der Gegenwart hausen. Ereignisse »brauchen keine Zeit, sondern bringen sie hervor« (Nassehi 2000, S. 41), indem die operationale Koppelung des Systems laufend zerfallende Ereignisse mit anderen zerfallenden Ereignissen relationiert. Die Systemzeit ist jene Zeit, die erzeugt wird durch die blinde Verkettung von zeitlosen Ereignisgegenwarten, die an vorangegangene Ereignisse anschließen. Blind, da auf der Ebene basaler Selbstreferenz schlicht geschieht, was geschieht, ohne dass dieses Geschehen im Moment des Sichereignens mitregistriert wird.
Beobachtungszeit als Nachtrag: Sobald ein System sich selbst mithilfe der Unterscheidung vorher/nachher beobachtet, erzeugt es eine Beobachtungszeit, die sich selbst stets zu spät kommt. So wie man den Lebenslauf von der Biografie unterscheiden muss, zugleich aber das Verfassen der Biografie selbst Moment des Lebenslaufes gewesen sein wird, so trägt der Einsatz von Vergangenheits- oder Zukunftsbezügen zur selbstreferenziellen systemzeitlichen Verkettung bei, ohne mit ihr zusammenzufallen. Ein System kann Vergangenes und Zukünftiges thematisieren – aber immer nur gegenwärtig. Dieser Lage begegnet die Theorie mit der Unterscheidung von Operation und Beobachtung. Während jede Beobachtung (also, dem systemtheoretischen Beobachtungsbegriff gemäß: eine Bezeichnung, die sich einer Unterscheidung verdankt) als Systemoperation zur Konstitution der Systemzeit beiträgt, kann sie ihre eigene Grundlage, ihre eigene Unterscheidung – die Unterscheidung, die sie trifft, indem sie dieses und-nicht-jenes bezeichnet –, nicht im selben Moment mitbeobachten. Dies kann nur nachträglich durch eine weitere Beobachtung erfolgen, für die dasselbe gilt. Beobachtungszeit ist nachträglich (hin)beobachtete Systemzeit. So etwa, wenn beobachtungszeitlich »einzelne« Ereignisse (genauer: Ereignisabstraktionen) identifiziert werden. Mit Blick auf die strukturelle Kopplung von Bewusstsein und Kommunikation wird die Synchronisation von psychischer und sozialer Zeit in der Moderne zum lebenspraktischen Problem (vgl. hierzu Nassehi 2008, S. 317 f.): Während in archaischen Zeiten Gesellschaft und Anwesendheitsbedingungen nahezu zusammenfielen und auch noch in stratifizierten Ordnungen die Lebenszeit in die v. a. zyklisch anfallenden Anlässe der Sozialsysteme sozusagen eingehängt war, wird es unter den modernen Bedingungen der funktional ausdifferenzierten Gesellschaft und der damit einhergehenden Vielheit von Systemeigenzeit prekär, von beobachteten Gegenwarten auf individuelle Vergangenheiten durchzurechnen, so wie es unbestimmter wird, welche Gegenwarten welche Zukunften herbeirufen (was sich etwa in der lebenspraktischen Ungewissheit spiegelt, welche Handlungen welche Erfolge zeitigen mögen). Die Unterscheidung Inklusion/Exklusion, welche die vormoderne Zugehörigkeit zu einer – und nur dieser – Schicht ablöst, treibt die psychischen Systeme in einen typisch modernen Individualitäts-Inszenierungsdruck (Individuum): An die Stelle des Sich-einrangieren-Lassens in hierarchisch strukturierte, zyklisch wiederkehrende »Aufgabenzeiten« tritt die Zeitarbeit an der (dann – etwa durch Biografisierung des Lebenslaufes: »eigenen«) Adresse, einer Art persönlicher Benutzeroberfläche, die für verschiedenste soziale Systeme attraktiv und lesbar sein muss (vgl. Hahn 1988; Schimank 1988).
Lebensformen (in wittgensteinscher Auffassung) lassen sich in diesem Sinne anhand ihrer Kombination von Praktiken, die eigene Lebenszeit zu beobachten, unterscheiden, also anhand spezifischer Routinen dafür, die psychische Systemzeit zu ordnen, zu strukturieren; die Praxis des Autobiografieschreibens etwa verweist auf andere systemische (Zeit-) Bedingungen als die zugemuteter Tatgeständnisse, Heldengeschichten erzeugen andere Beobachtungszeit als Stechuhr-Chipkarten.
Unter Interventionsaspekten verweist Zeit auf das Grundproblem jeglicher Eingriffsabsichten: dass Systeme operational geschlossen operieren und somit gegenseitige Kausaleingriffe nur behauptet, aber nicht realisiert werden können. Kommunikationssysteme und Bewusstseinssysteme operieren unter Gleichzeitigkeitsbedingungen; sie warten mit ihren systemspezifischen Operationen nicht aufeinander, sondern operieren stattdessen strukturell gekoppelt. Der Versuch, aufeinander einzuwirken, führt zu Interventions- bzw. »Drittsystemen« (Fuchs 1999), die eigene System-und Beobachtungszeit in Gang setzen, welche die strukturell gekoppelten Bewusstseinssysteme in der Umwelt der Interventionssysteme mit Irritationsanlässen versorgen; mit Irritationen, die jedes Bewusstsein – ob Berater oder Beratener, ob Therapeut oder Klient – gemäß den eigenen Strukturen in spezifische Eigenleistungen umsetzt (»sich einen Reim darauf macht«) oder auch nicht. Die Inanspruchnahme der Zeitdimension ermöglicht zusätzliche Freiheitsgrade in der Sach- und Sozialdimension. Durch regelmäßige Termine, Jours fixes usw. etwa kann sich ein Interventionssystem »über die Zeit« fortsetzen, ohne darauf angewiesen zu sein, dass immer nur ein spezifisches Thema (anhand dessen sich das System erkennt) bearbeitet wird oder dass stets dieselben Personen anwesend sind. Die Beobachtungszeit eines Interventionssystems, auf das sich die psychischen Systeme einstellen, kann je nach Taktung und Rhythmus unterschiedliche Irritationen und Irritationsstile anbieten, von »den Klienten Zeit lassen« über »zeitliches Ziel aushandeln« bis hin zu »Zeitdruck« oder »Abbruchsankündigungen«.
Verwendete Literatur
Fuchs, Peter (1999): Intervention und Erfahrung. Frankfurt a. M. (Suhrkamp).
Weiterführende Literatur