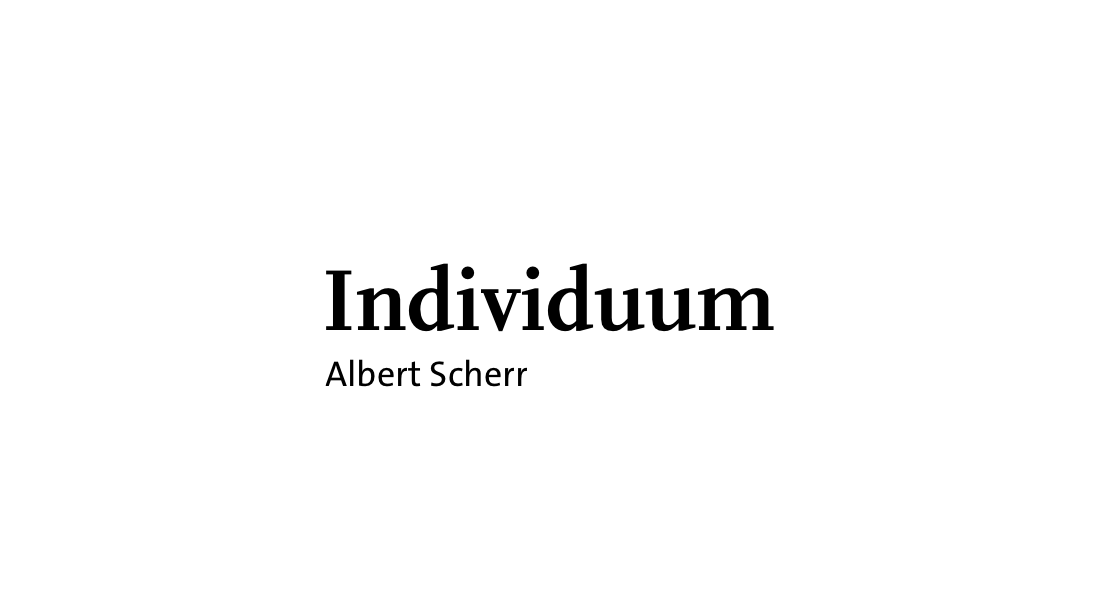Identität
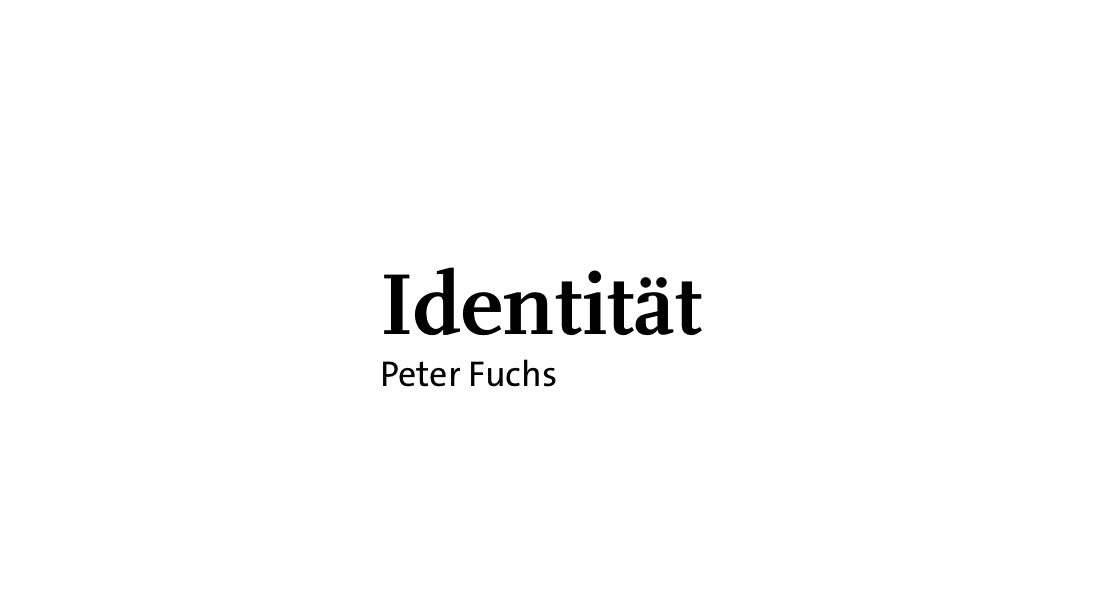
engl. identity, franz. identité f, von lat. idem »derselbe, dasselbe, der Gleiche«. Die ehrwürdige Idee, »Identität« bezeichne so etwas wie die Wesenseinheit desselben mit sich selbst oder die Selbigkeit des Selben in einer Welt der Selbigkeiten, hat unter Modernitätsbedingungen entschieden an Überzeugungskraft verloren. Das gilt auch für das, was man mitunter »personale Identität« nennt. Spätestens mit dem Aufkommen konstruktivistischer Beobachtungsmöglichkeiten wird auch sie als Konstruktion begriffen, die auf das Problem reagiert, wie in einer unentwegt vergehenden Zeit, in der von Moment zu Moment nichts bleibt, wie oder was es ist, noch verlässlich fixiert werden kann, wer jemand zeitübergreifend »tatsächlich« ist: hinter allen Masken. Dieses theoretische Problem tangiert allerdings die alltäglichen Lebensvollzüge nicht sonderlich, man weiß im Allgemeinen, mit wem man verheiratet ist, wie die eigenen Kinder heißen und welche Automarke man fährt. Daneben gibt es sicherlich finanziell konsolidierte und nicht selten therapienahe (Therapie) Sozialkontexte (Kontexte), in denen es zum Lebens-Chic gehört, die je eigene Identität zu suchen, zu finden, zu wechseln. Die These der folgenden Überlegungen ist jedoch, dass praxisbezogenes systemisches Arbeiten, das man sich konstruktivistisch grundiert vorstellen muss, gerade nicht die Suche nach der verlorenen Identität betreibt, sondern im Gegenteil daraufhin ausgelegt ist, Identitätsprätentionen zu vermeiden.
Identität kann unter systemisch-konstruktivistischen Vorzeichen nur als Konstrukt begriffen werden. Als Identität gilt, was unter je gegebenen sozialen Konditionen als Identität plausibel und anschlussfähig ist. Mit diesem Konzept entledigt sich systemisches Arbeiten philosophisch möglicher Tüftel- und Grübelprobleme und setzt auf attributionstheoretische Strategien, die im Kern besagen, dass Identität (hier die von Menschen) »hinbeobachtet« wird. Sie ist kein factum brutum, sie ist das Resultat hochkomplexer Zurechnungsroutinen, die aber wie in einer Faktizität 2. Ordnung massive Folgen für die Lebens- und Kommunikationschancen der Leute entfalten. Das Problem lässt sich im Kontext systemischen Arbeitens auf mehreren Schauplätzen durchspielen.
(1) Identitätskonstruktionen sind vor allem ausnahmslos Festlegungen. Mit ihnen werden, wo immer sie im Einsatz sind, Seinsbehauptungen aufgestellt und festgezurrt, die sich an einem »ist« erkennen lassen. Jemand ist ein penibler Mensch, ein sorgsamer Vater, eine überbehütende Mutter, ein Behinderter (Behinderung), eine Alkoholikerin (Abhängigkeit), ein gewaltbereiter (Gewalt) Jugendlicher, ein Mädchen mit Migrationshintergrund, ein Genie, eine Frau, ein Mann, ein Kinderschänder, eine Analphabetin, ein ADHS-Kind ... Solche Zuschreibungen reduzieren alltäglich Komplexität, indem sie schnelle Orientierung ermöglichen, und sie steigern Komplexität, weil sie in dieser Funktion dramatische Ausblendungsleistungen darstellen. Sie dunkeln das »Sonst- noch« der betroffenen Leute ab. Da es beim systemischen Arbeiten überwiegend um dieses Sonst-noch geht, ist eine wichtige Konsequenz, dass es sich nicht selbst in das Spiel der Identitätskonstruktionen verwickelt. Es müsste daran erkennbar sein, dass es Identitätsfixierungen vermeidet und Alternativität, bezogen auf Identitätskonstruktionen, im Blick behält. Ein Leitsatz wäre: »Niemand ist – jenseits seines Eigennamens – genau und sicher der und der ...« Dieses Verdikt schließt Kategorisierungen und Eindeutigkeitsdiagnosen (Diagnose) aus (mehr: Fuchs 2011).
(2) Identitätskonstrukte sind einerseits Orientierungserleichterungen, andererseits soziale Sinnzumutungen. Sie bürden Menschen die Last auf, ein bestimmtes (identitäres) Sein zu sein, zu haben, sein zu sollen. Wenn es dabei nicht um schematisierte Attributionen geht im Sinne der Rollentheorie, sondern um individualisierte (Individuum) Zumutungen, spricht Niklas Luhmann von der sozialen Adresse der Person (Luhmann 1995; Fuchs 2003). Da dieser Ausdruck hier nicht Menschen meint, sondern die Zurechnung »individuell attribuierter Verhaltenseinschränkungen«, gewinnt Luhmann die Chance, den Begriff »Unperson« einzuführen. Er besagt, geballt formuliert, dass psychische Systeme (Psyche), konfrontiert mit jenen Sinnzumutungen, sich intern (also lautlos) gegen sie absetzen, also eine Art Binnenindividualität durch innere Devianz aufbauen können, gleichwohl aber im manifesten Verhalten der je zugeschriebenen identitären Individualität entsprechen. Das Wort »manifest« verweist auf das Schema manifest/latent, damit aber auch auf die nichtsystemische, im Kern psychoanalytische Idee, dass hinter der körperlichen (Körper) Oberfläche das psychische Geschehen steckt, das zu manipulieren ist, in das zu intervenieren ist (Intervention) und das zu beeinflussen ist. Im Zentrum einer möglichen Gegenargumentation stünde das von der neueren Systemtheorie entwickelte Konzept selbstreferenziell (Selbstreferenz) geschlossener Systeme, die Operationen weder importieren noch exportieren können. Daraus folgt, dass systemisches Arbeiten sich auffassen lässt als spezifische Irritations-, mithin Störtechnik im Blick auf eingefahrene Identitätskonstruktionen.
(3) Das Konstrukt der Identität gewinnt eine zusätzliche Facette, wenn man es einstellt in eine gesellschaftstheoretische Perspektive. Im Übergang von der stratifizierten Ordnung des Mittelalters zur funktionalen Differenzierung, die die Moderne kennzeichnet, wird das Thema individueller Identität virulent im Zuge der sozialen Sprengung dessen, was diese Identität hätte bedeuten können, wenn sie zuvor fraglich oder problematisch gewesen wäre. Die Formulierung klingt seltsam, aber soll nur besagen, dass – summarisch formuliert – personale Identität unter Stratifikationsbedingungen typologisch errechnet wurde bzw. legendär war, also gerade nicht individuell. Mit der funktionalen Differenzierung werden solche Schematisierungen abgelöst durch das Erleben und das Thematisieren von fragmentarischer Identität, durch, wie man sagen könnte, die Normalität multipler Personalität (viel umfangreicher: Fuchs 2010). Es ist dieser Gesichtspunkt, der es zulässt, für systemisches Arbeiten eine idealtypische Bifurkation zu prognostizieren. Es steht gleichsam vor einer Grundsatzentscheidung. Systemische Arbeit kann weiterhin am Konzept der zu rekonstruierenden (gelingenden oder scheiternden) personalen Identität festhalten. Sie wäre dann verwickelt in einen struggle for identity. Oder: Sie verhält sich konziliant gegenüber dem Konzept multipler, »proteischer« Identität und lässt sich darauf ein, dass Identität in der Moderne via Personalausweis, Fingerabdruck, DNA-Test etc. ermittelt wird und darüber hinaus nichts ist als ein Syndrom vermaschter Konstrukte, das nicht mehr auf eine Einheit, also gerade nicht auf Identität zurückgeführt werden kann. Man kann den Eindruck gewinnen, dass im Blick auf jene scharfe Bifurkation systemisches Arbeiten gegenwärtig eher das Bild einer opaken, theoretisch undurchdrungenen Gemengelage abgibt.
Verwendete Literatur
Weiterführende Literatur