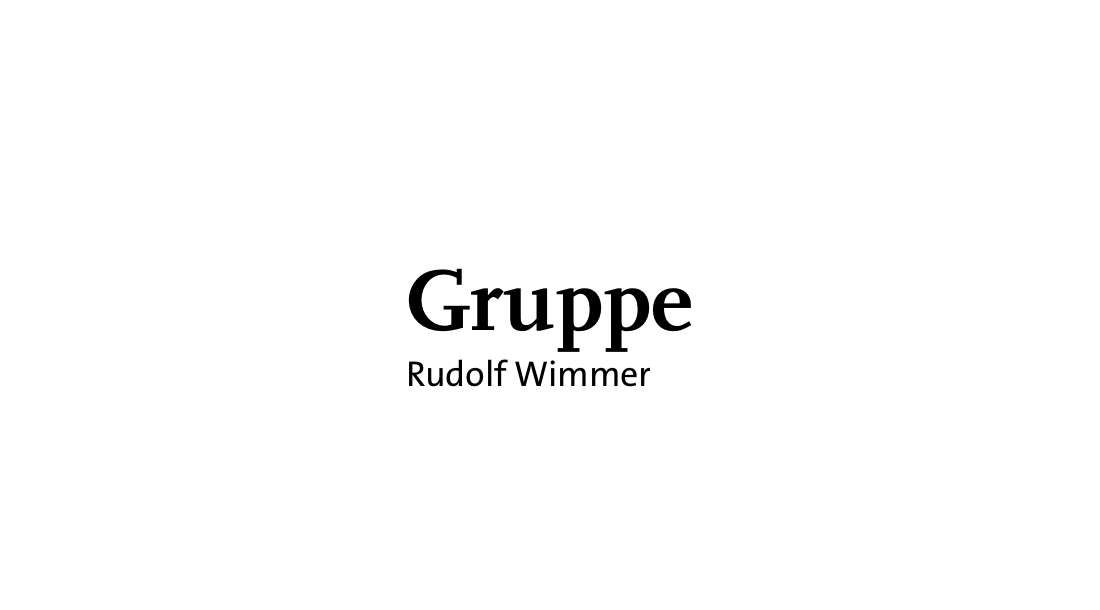Evidenz

von engl. self-evidence, franz. évidence f, lat. evidentia = »Augenscheinlichkeit, Anschaulichkeit« bzw. von ex = »aus« und videre = »sehen«, »das Herausgesehene«, aber auch »das Herausscheinende, das Durchsichtige«. Der Begriff bezeichnet »Offenkundigkeit, völlige Klarheit« bzw. »das dem Augenschein nach Unbezweifelbare, das durch unmittelbare Anschauung oder Einsicht ohne Überprüfung Erkennbare«, aber auch, im Kontext evidenzbasierter Medizin vom engl. evidence = »Beweis«, abgeleitet: »Nachweis« und bezieht sich dann auf Informationen aus wissenschaftlichen Studien, insbesondere aus solchen mit streng zufällig den Untersuchungs- und Kontrollgruppen (Gruppe) zugeordneten Probanden (Randomized Controlled Trials; RCT) und mit systematisch zusammengetragenen klinischen Erfahrungen (Evaluation), die einen Sachverhalt erhärten oder widerlegen.
In der Philosophie gibt es mehrere Definitionen (siehe z. B.: https://de.wikipedia.org/wiki/Evidenz). Nach Edmund Husserl ist Evidenz eine aktive Leistung des Bewusstseins, Wolfgang Stegmüller sieht sie als Einsicht ohne methodische Vermittlungen an und ist der Meinung, dass all unser Argumentieren, Ableiten, Widerlegen, Überprüfen ein ununterbrochener Appell an Evidenz ist (Stegmüller 1969). Evidenz ist eine Art des Sehens und kann in der systemischen (System) Theorie als Gegenposition zur Haltung des Nichtwissens verstanden werden. Mittelbare Evidenz liegt vor, wenn eine Aussage nicht unmittelbar einsichtig ist, sich jedoch aus einzelnen, miteinander verbundenen und jeweils für sich unmittelbar evidenten Aussagen herleiten lässt. Evidenzbasierte Medizin (ebM) bzw. evidenzbasierte Praxis ist die nachweisorientierte Versorgung eines Klienten auf der Basis der besten zur Verfügung stehenden Daten. EbM umfasst die systematische Suche nach Evidenz in der Fachliteratur für ein konkretes Problem oder eine bestimmte Krankheit/Diagnose, ferner die kritische Beurteilung der Validität nach klinisch-epidemiologischen Gesichtspunkten, die Bewertung der Effektstärke sowie die Anwendung auf den Klienten mittels der klinischen Erfahrung und der Vorstellungen des Klienten. Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung wendet ebM-Prinzipien auf alle Gesundheitsberufe und Bereiche der Gesundheitsversorgung an, auch auf Entscheidungen zur Steuerung des Gesundheitssystems.
Zwecks struktureller Kopplung an das Klientensystem kann es sinnvoll (Sinn) sein, nicht zu viel infrage zu stellen, sondern einige Verknüpfungen im Glaubenssystem des Klientensystems bestehen zu lassen, da umfassendes Infragestellen zu zu starker statt »angemessen ungewöhnlicher« Irritation bzw. Intervention führen würde. Evidenz kann für das Klientensystem und/oder Behandlersystem einen Anker, einen Ort des Vertrautseins (Evidenzerlebnis) und Verstehens darstellen. Der Gebrauch von Metaphern kann bewirken, dass für zwei Phänomene, die sonst nicht assoziiert sind, gemeinsame Wissens- und Glaubenssysteme Bedeutung erlangen und dadurch Evidenz erzeugt wird. Für den systemischen Therapeuten (Therapie) stellt Evidenz aber auch die Gefahr des »Verheiratetseins« mit einer oder mehreren Hypothesen (Hypothetisieren) dar, die zwar aus Therapeutensicht evident, für das Klientensystem aber nicht unbedingt hilfreich sind. Eine weitere Gefahr besteht darin, vorschnell Übertragbarkeit aus einem anderen Einzelfall anzunehmen: Anekdotische Evidenz ist nicht stets typisch. Aber auch statistische Evidenz, wie sie z. B. RCTs vermitteln, ist nicht immer auf den Einzelfall übertragbar: In der ebM wird zwar mittels Evidenzklassen die wissenschaftliche Aussagefähigkeit klinischer Studien beurteilt, und systematische Übersichten bzw. RCTs stehen hier an oberster, bloße Expertenmeinungen dagegen an letzter Stelle der Beurteilungshierarchie, obwohl RCTs ein hoch artifizielles Milieu abbilden, das mit der Klientenversorgung im Alltag ggf. wenig zu tun hat. Evidenzklassen für sich allein erlauben jedoch noch keine Einschätzung der klinischen Relevanz von Studienergebnissen (https://www.leitlinien.de/).
Der Empfehlungsgrad orientiert sich daher auch an klinischer Relevanz (sie betrifft u. a. Effektstärken und Konsistenz der Studienergebnisse, Relevanz der Kontrollgruppen und verwendeten Therapieintensitäten), an der Umsetzbarkeit in der Versorgungsrealität sowie am Abwägen von Nutzen und Risiko (https://www.awmf.org/leitlinien/aktuelle-leitlinien.html). Als Resultat eines Expertenkonsenses kann z. B. eine Empfehlung auch ohne hochstehende Evidenz einen hohen Empfehlungsgrad erhalten. Verbreitet ist die Einteilung in vier Empfehlungsgrade von A (»Soll-Empfehlung«, für die zumindest 1 RCT von guter Qualität und Konsistenz vorliegt) über B (»Sollte-Empfehlung«: gut durchgeführte klinische Studien, aber keine RTC) bis 0 bzw. C (»Kann-Empfehlung«: Expertenmeinung), zusätzlich gibt es die Kategorie KKP (»klinischer Konsenspunkt«: gute klinische Praxis als Standard in der Behandlung, bei der keine experimentelle wissenschaftliche Erforschung möglich oder angestrebt ist). Die ebM-Systematik generiert auch für die systemische Therapie Kriterien dafür, wie umfassend belegt die Wirksamkeit einer Intervention/eines Ansatzes bei einer bestimmten Störung ist. Somit kann ebM innerhalb des Spektrums systemischer Schulen/Methoden bei der Auswahl Erfolg versprechender Interventionen hilfreich sein, aber auch psychotherapieschulenübergreifend.
Zum rechtlichen Stellenwert von Leitlinien: Leitlinien sind nicht verpflichtend, können jedoch für systemische Therapeuten rechtliche Bedeutung erlangen, wenn sie z. B. vor Gericht als Hilfsnormen angewendet werden. Das Abweichen von einer Leitlinie stellt nicht per se einen Behandlungsfehler dar und wird kaum als fahrlässiges Verhalten ausgelegt werden, solange die betreffende Vorgehensweise so gut etabliert ist, dass kein verantwortlicher Therapeut sie außer Acht lassen würde. Eine Leitlinie kann auch zur Umkehr der Beweislast führen: Hat ein Therapeut eine Leitlinie nicht befolgt, wird von ihm u. U. der Nachweis verlangt, dass der dem Patienten zugefügte Schaden nicht durch das Nichtbefolgen der Leitlinie entstanden ist (Europarat 2002). Andererseits ist der Therapeut verpflichtet, in seinem Vorgehen von der betreffenden Leitlinie abzuweichen, wenn dies im Einzelfall erforderlich ist, um Schaden vom Klienten abzuwenden bzw. das bestmögliche Behandlungsergebnis zu erzielen (Ziel). Psychotherapieaus- und -weiterbildung als Modifikatoren von Evidenz: Durch die intensive Beschäftigung mit den schulenbezogenen Theorieinhalten und das Erleben der Dozenten werden sehr intensiv Sichtweisen vermittelt mit dem Ziel, dass der Lernende andere Evidenz erblickt als zuvor. Die Haltung des Nichtwissens sollte sich daher nicht nur auf Hypothesen, sondern auch auf die Prämissen der eigenen Psychotherapieaus- und -weiterbildung erstrecken.
Verwendete Literatur
Ströker, Elisabeth (1978): Husserls Evidenzprinzip. Sinn und Grenzen einer methodischen Norm der Phänomenologie als Wissenschaft. Zeitschrift für philosophische Forschung 32 (1): 3–30.
Weiterführende Literatur